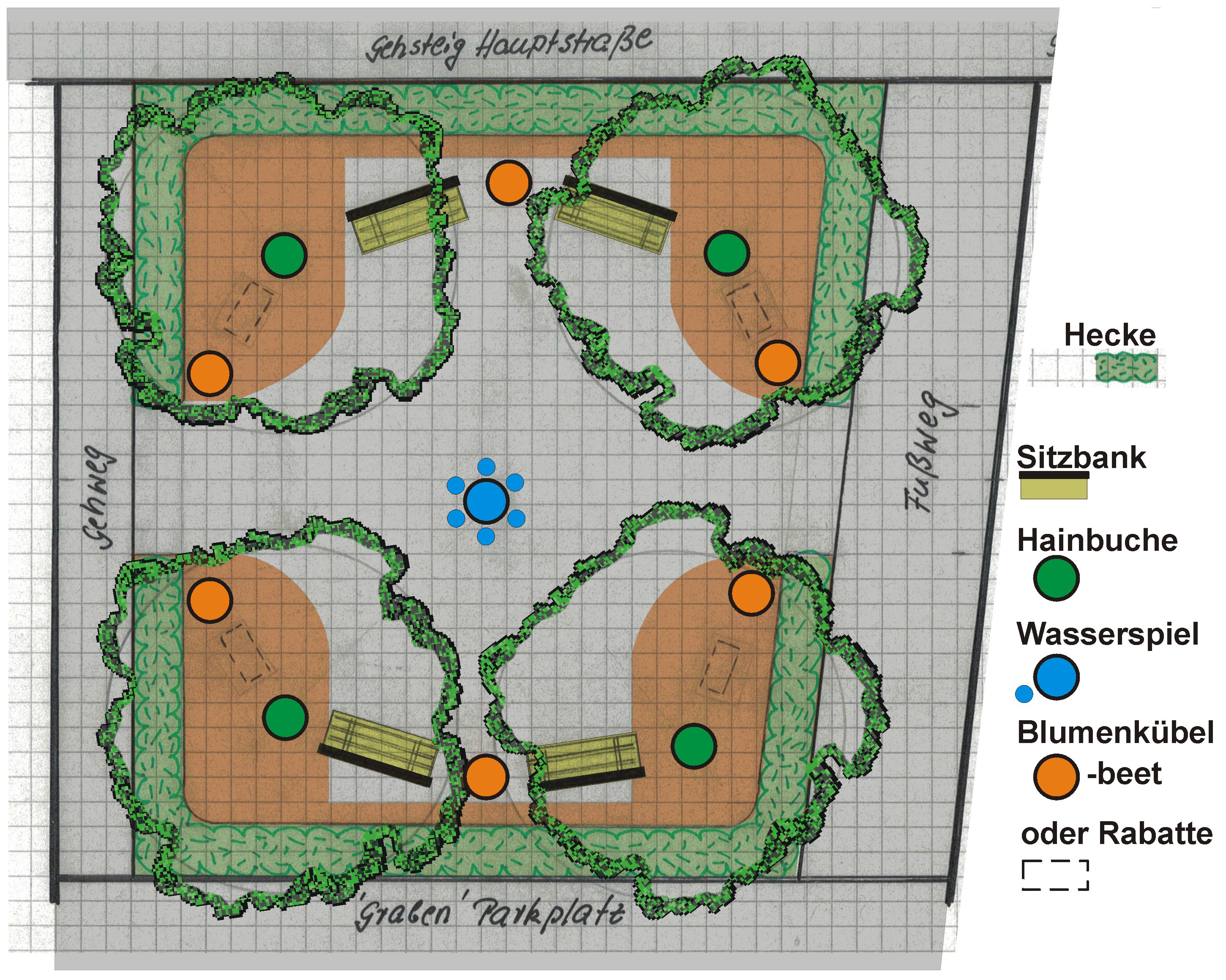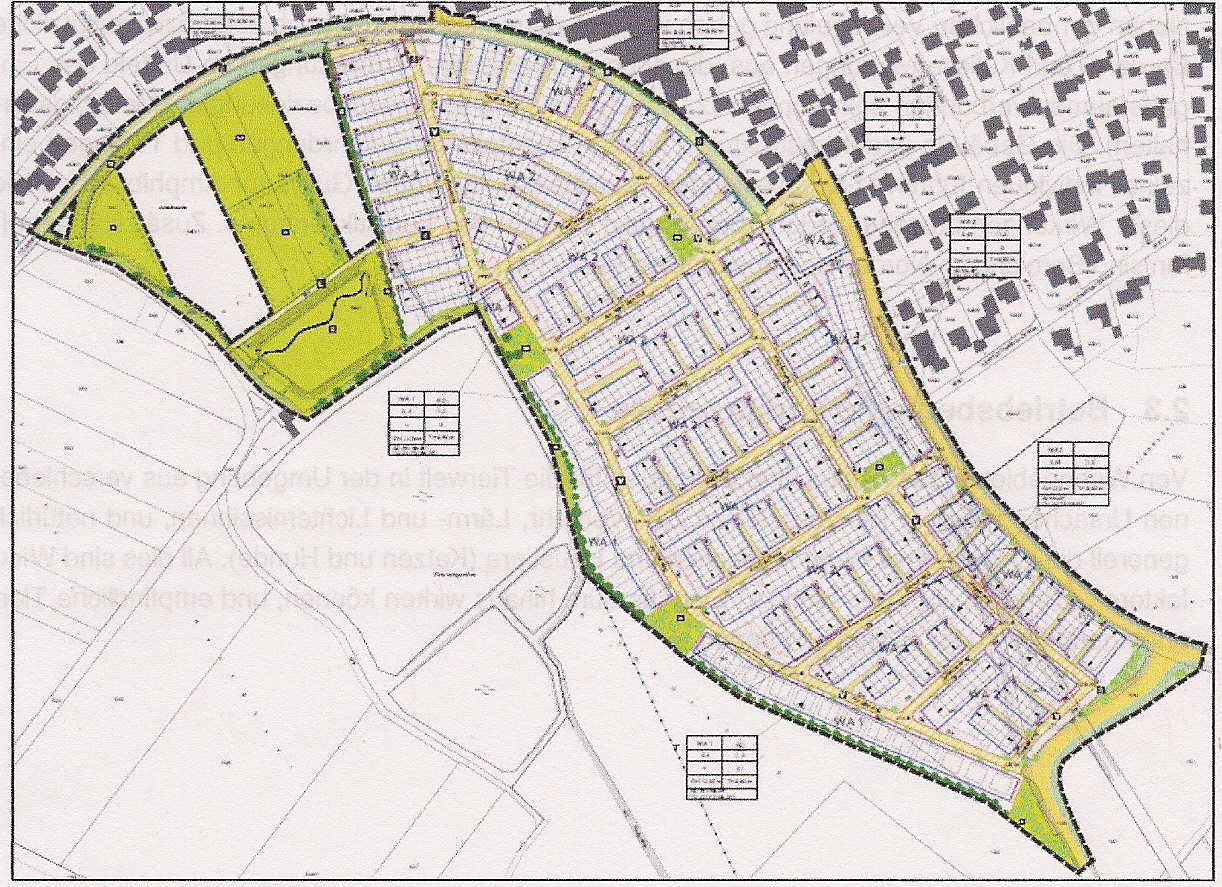Pressemitteilungen/Stellungnahmen/Öffentliche Briefe
Pressemitteilungen vergangener Jahre
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
26.03.2024 - Heckenrodung Häckersteig VI
20.02.2024 - Amphibienausstellung - Sammlung gestartet
08.05.2023 - Erneute frühzeitige Auslegung des FNP der Stadt Höchstadt
09.12.2022 - Nahwärmenetz Adelsdorf
02.12.2022 - PV-Freiflächenanlage Medbach
30.11.2022 - ERH im Mittelfeld beim Ausbau der Erneuerbaren
18.11.2022 - Zerstörung eines geschützten Feuchtbiotops
17.10.2022 - Flächenfraß stoppen, Energiewende voranbringen
02.09.2022 - Ausgleichsflächen für Aischtalring überdenken
15.08.2022 - Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke
28.06.2022 - Potenzialanalyse PV-Freiflächenanlagen
13.05.2022 - Fakten gegen die Südumfahrung
07.02.2022 - Anmerkungen zum Start Bürgerentscheid Südumfahrung
01.02.2022 - Herzogenaurachs Klimaschutzziele werden haushoch verfehlt
26.03.2024 - Heckenrodung Häckersteig VI
Der BUND Naturschutz hat kürzlich die aktuelle Bebauung am Häckersteig besichtigt. Dabei wurde der bereits bestehende Bebauungsplan Häckersteig VI in der nordöstlichen Ecke des Häckersteigs mit der Realität verglichen. „Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass ein Grundstücksbesitzer einen Teil der dort geschützten Hecke zerstört hat. An diesem Naturfrevel hat allerdings auch die Stadt Höchstadt eine Mitschuld.“ betont der BN-Kreisvorsitzende Helmut König und unterstreicht, dass „die aktuelle Bauleitplanung eine Zerstörung von Hecken geradezu provoziert. Diese Umgebung eignet sich nicht für eine naturverträgliche Bebauung.“
Das Baugebiet Häckersteig VI wurde schnell noch vor der ersten Veröffentlichung des neuen Flächennutzungsplanes zur Bebauung freigegeben. Typisch für den Häckersteig sind die Heckenzeilen mit dazwischenliegenden Freiflächen. In eine dieser Freiflächen wurde nun eine Reihe von acht Häuser geplant, die obendrein die Kaltluftzufuhr in die Stadt blockieren. Zwei stehen bereits. Die Hanglage erschwert die Anlage des Freiplatzes vor der Terrasse – ein weiteres Problem für den Heckenbestand.
Im unteren Bereich der Grundstücke liegt die erste Heckenzeile. „Wie alle Hecken im Häckersteig sind das geschützte Hecken, sind kartierte Biotope nach Naturschutzgesetz und dürfen nicht entfernt werden. So steht es auch im Bebauungsplan und diese Auflage muss zur Genehmigung des Bauplans vom Bauherrn unterschrieben werden.“ erläutert König. „Sogar eine Pufferzone ist zusätzlich vorgeschrieben.“
Nun wurden die Heckenzeilen allerdings den privaten Grundstücken zugeordnet. „Schon in unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2019 haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass dies der Zerstörung der Hecken Vorschub leistet. Die Hecken sollten Eigentum der Kommune bleiben. Nur so kann der Erhalt und auch die Pflege gewährleistet werden.“ so König. „Aber die Stadt(räte) war(en) clever. Selbst der Grünbereich zwischen zwei Heckenzeilen unterhalb der Baugrundstücke wurde den Privatpersonen zugeordnet und verkauft, obwohl diese als Ausgleichsfläche festgelegt wurde. Die Stadt verkauft sozusagen im großen Stil schutzwürdige Natur.“ Der absolute Frevel ist, dass selbst in der Ausgleichsfläche von einem Grundstücksbesitzer die Hecke gerodet wurde, obwohl die Stadt bereits dort Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt haben sollte. Aber auch das ist durch das Landratsamt noch zu prüfen“.
Der BN befürchtet, dass die Heckenzerstörung auf den westlich gelegenen, noch unbebauten Grundstücken nun Schule macht. Der BN erwartet, dass die Stadt hier einen Riegel vorschiebt und die Bautätigkeiten auch überwacht und Rodungen unterbindet. Letztendlich drohe dem gesamten Häckersteig bei solcher Vorgehensweise langfristig die Zerstörung. König empfiehlt der Stadt dringend, von einer Bebauung des Häckersteigs abzulassen und verweist auf die Stellungnahme des BN: „Es werden nicht nur Hecken zerstört, sondern den Tieren ihr Lebensraum genommen. Letztendlich verliert die Natur, der Artenschutz samt Mensch und das im gesamten Häckersteig. Der BN hat deswegen bei der Bauüberwachung am Landratsamt Anzeige erstattet.“
Für Rückfragen:
Helmut König, Vorsitzender
20.02.2024 - Amphibienausstellung - Sammlung gestartet
Am 20.02.2024 eröffnete der Bund Naturschutz (BN) im Röttenbacher Rathaus eine Wanderausstellung über die Amphibien unserer Region, die ab März in Herzogenaurach und ab April in Heßdorf zu sehen sein wird. Der Ortsvorsitzende Christoph Recher begrüßte Harald Rotschka, den zweiten Bürgermeister Röttenbachs, sowie den Kreisvorsitzenden Helmut König und die Biologin und Ortsvorsitzende im Seebachgrund, Elke Seyb. Auf 13 Infotafeln wird die allgemeine Situation der meist streng geschützten Tiere dargestellt. Eine Tafel bezieht sich dabei auf die lokale Situation im Landkreis.
Nach Rotschkas Grußwort schilderte König die aktuelle Situation der Amphibienwanderung, die aufgrund der frühzeitigen und ungewöhnlich hohen Temperaturen in vollem Gange ist.
Dabei bemängelte er neben dem Hauptstörfaktor Klima- bzw. Temperaturkapriolen auch die zunehmende Bürokratie und die damit verbundenen Prozessketten und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Behörden und den Sammlern. Auch spielen Personalmangel oder Krankheitstage eine Rolle. Regierung, Straßenbauämter, Kreis- und Gemeindebauhöfe müssen eingeschaltet werden und ihre Prozesskette muss strikt eingehalten werden. „Ist uns absolut verständlich, aber manchmal wird übertrieben“ betonte König. „So werden kurzfristig neue, selbst beim TÜV noch nicht notwendige Schutzwesten vorgeschrieben, die erst bestellt, geliefert und an die Sammler verteilt werden müssen. Das verzögert den Sammelstart um zwei Wochen, voraussichtlich noch mehr. In der Zwischenzeit hat die Wanderung begonnen und der größte Schwung der Amphibien ist gestartet. Das Ergebnis kann man an den platt-gefahrenen Tieren auf der Straße besichtigen.“ Auch müssen Duldungserlaubnisse von den einzelnen Straßenbehörden eingeholt werden. Die Übergänge sind seit Jahren immer die gleichen.
Die hohen Tag/Nacht-Temperaturschwankungen, bedingt durch unsere Klimaänderungen, zwingen zu einer schnelleren und effektiveren Amphibienrettung. Die Ausstellung zeigt eindrücklich, auf der lokalen Auswertung basierend, dass die Zahl von Fröschen, Kröten und Molchen an den Übergängen stetig sinkt. „Die Sammler reparieren ja nur die Fehler früherer Straßenplanungen, welche Amphibien-Wanderwege durchschnitten hatten. In 20 Jahren wurden an insgesamt 11 Übergängen im westlichen Landkreis alleine über 110000 Erdkröten über die Straße geholfen.“ so König.
Die Kreisgruppe bedankt sich aber ausdrücklich bei der Unteren Naturschutzbehörde und den Bauhöfen. Dort sind die Probleme bekannt und es wird auch sukzessive verbessert und daran gearbeitet. So hat der Kreisbauhof begonnen, an den Übergängen feste Zäune zu installieren. Damit wird das Problem Schneeräumung beseitigt. Es muss aber auch geprüft werden, ob die Durchgänge unter der Straße auch angenommen werden. Leider gibt es auch unerwartete Zwischenfälle „So ist letztes Jahr bei einer Feuerwehrübung das Wasser aus einem gerade abgelaichten Teich als Spritzwasser abgepumpt worden“ erwähnt König, „die Übergangsbetreuerin Monika Beck war entsetzt.“
Man bat nochmals eindringlich die Autofahrer um Rücksicht an den beschilderten Amphibienübergängen. Manche Strecken liegen in Kurven und sind nicht wirklich einsehbar. „Bisher hatten wir nur tote Amphibien.“
Zum Schluss erklärte Elke Seyb die hauptsächlich bei uns über die Straßen wandernden Amphibien. Dazu zählen am häufigsten die Erdkröten. Die Grasfrösche sind schon um zwei Zehnerpotenzen seltener. Alle anderen werden in sehr unterschiedlicher, höchstens zweistelliger Zahl an den Übergängen angetroffen. Dazu zählen dann Wasser- und Teichfrösche, Teichmolche, Bergmolche und Laubfrösche. Auch Knoblauchkröten und sogar einige Moorfrösche wurden schon gerettet. Gerade letztere Art ist im Landkreis stark gefährdet. Trotz intensiver Maßnahmen durch die lokale Naturschutzbehörde geht der Bestand erschreckend zurück. „Seit 2019 verharrt die Population auf niedrigen Werten und steht am Rande des Aussterbens. Schuld ist die Klimaveränderung, der Wassermangel im Frühjahr und als Folge die trockenen Teiche im Sommer.“ zitiert die Biologin aus Fachkreisen.
Für Rückfragen:
Helmut König, Vorsitzender
08.05.2023 - Erneute frühzeitige Auslegung des FNP der Stadt Höchstadt
Der BN lehnt den Vorentwurf des Flächennutzungsplans (FNP) ab. Die erste Stellungnahme vom 24.05.2021 ist weiterhin gültig. Wesentliche Änderungen zur 2. Version des Vorentwurfs werden nachfolgend ausgeführt. Hauptablehnung des BN ist der Gesamtflächenverbrauch, der auch durch die neue Vorversion 2 nicht gravierend verringert wurde. Immer noch ist der Bedarf gegenüber dem Ziel der Regierung (Koalitionsvertrag CSU/FW) zu hoch.
In der Begründung wird beschrieben, dass „verschiedene Randbedingungen wie Autobahn, Wald, Überschwemmungsgebiet u.a. weitere Siedlungsflächen kaum noch ermöglichen.“ Auch muss berücksichtigt werden, dass „auf unbebaute Freiflächen kaum Zugriff möglich ist“, so wird es im FNP erläutert. Daraus wird als Ziel der Stadt genannt, dass „zukünftig durch Aktivierungsstrategien ein möglichst großer Anteil dieser Flächen aktiviert werden sollen. Die Ergebnisse sollen in der Planung berücksichtigt werden.“ Dieser Ansatz zur Innenentwicklung wird vom BN ausdrücklich befürwortet.
Daraus sollte folgen, dass nicht vor den intensiven Bemühungen geeignete Freiflächen zu finden, eine Entwertung des Häckersteigs durch die Wohnbauflächen 1.1. bis 1.3 erfolgen darf. Folglich wäre damit auch zukünftig der einzig richtige Weg, die Innenentwicklung zu forcieren, da wohl die genannten Grenzflächen auch in der Zukunft weiterhin vorhanden sind, und somit nicht zur Verfügung stehen.
Da ja Wohnbedarf vorliegt, sollten also weitere moderne, zukunftstaugliche Siedlungsstrukturen angestrebt werden. Dies könnte durch komprimierte Bauweisen mit weitestgehend zurückgedrängtem Straßenbau in Verbindung mit Gemeinschaftsflächen für Kommunikation und Spielraum erfolgen (Beispiel Büchenbach, Hofer Straße).
Auch sollten sektorweise die Bauleitpläne überarbeitet und modernisiert werden, um z.B. zusätzliche Bauflächen oder Anbauten auf größeren Grundstücken oder Aufstockungen zu ermöglichen.
Auch ohne den genannten Flächen 1.1 bis 1.3 bleiben im FNP immer noch 31,32 ha Bauflächen verfügbar (W+M). Dies sollte im Vergleich zu anderen Kommunen für die prognostizierte Bevölkerungsprognose (2020-2039) von 621 Personen (Anlage 1: Bedarfsermittlung Wohnflächen, Seite 11) aus ökologischen wie nachhaltigen Gründen reichen. Zählt man die aktuell genannten Anfragen (von angeblich 400 Interessenten) zur Prognose hinzu und teilt durch die Belegungsdichte, so erhält man eine Bruttogrundfläche von 675m² je Wohneinheit.
Für Rückfragen:
Helmut König, Vorsitzender
09.12.2022 - Nahwärmenetz Adelsdorf
Wir befürworten das geplante Heizhaus am Rande der Aischwiesen, da es keinen alternativen Standort gibt, um die Wärmeversorgung effektiv zu ermöglichen.
Wir müssen aber darauf hinweisen, dass das Verbrennen von Holz ohne eine kaskadierende Vornutzung schädlich für die aktuelle Klimaproblematik ist. Das erlaubte CO2-Budget wird dadurch zusätzlich belastet. Daher sollte so viel wie möglich durch weniger CO2-belastete Wärmeerzeugung realisiert werden (z.B. Solarthermie, Geothermie, Wärmepumpen, etc.). Auch sollte miteinkalkuliert werden, später die Verbrennungsöfen für andere Brennstoffe umzurüsten (z.B. Grünes Gas) oder durch andere Technologien zu ersetzen.
Außerdem darf nur Holz aus dem lokalen Umfeld verwendet werden. Es muss sichergestellt werden, dass eine Regeneration des Kohlenstoffbestandes im zeitlichen Rahmen der Klimaziele weitestgehend sichergestellt wird.
Für Rückfragen:
Helmut König, Vorsitzender
02.12.2022 - PV-Freiflächenanlage Medbach
Das Plangebiet wird von uns als geeignet für eine PV-Freiflächenanlage eingestuft und liegt außerhalb von naturschutzrelevanten Ausschlussgebieten. Die Ausführung und die Maßnahmen entsprechen weitestgehend unserem Kriterienkatalog.
Der BN priorisiert Photovoltaik auf Dächern, an Fassaden und technischen Infrastrukturen. Das Potenzial der Photovoltaik auf Dächern und an Gebäuden kann aber bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Photovoltaik auf Dächern ist in einem vertretbaren Zeithorizont, den uns die Klimakrise lässt, nicht realisierbar. Daher sind Freiflächenanlagen notwendig, soweit sie umweltverträgliche Bedingungen erfüllen.
Diese sind aus unserer Sicht im vorliegenden Fall erfüllt. Wir bestätigen, dass im Umfeld keinerlei Schutzgebiete oder Vorrangflächen des Naturschutzes vorhanden sind, die bedroht werden. Auch das Landschaftsbild wird nicht übermäßig beeinträchtigt.
PV-Freiflächenanlagen können bei richtiger Planung und Pflege einen zusätzlichen Gewinn für die Biodiversität bedeuten und damit wertvolle Trittsteine in der offenen Agrarlandschaft und Elemente eines Biotopverbundes sein. Wir unterstützen die Vorgaben der Triesdorfer Biodiversitätsstrategie für PV-Anlagen und weisen zusätzlich auf die Möglichkeit einer Zertifizierung hin.
Für Rückfragen:
Helmut König, Vorsitzender
30.11.2022 - Landkreis Erlangen-Höchstadt liegt im Mittelfeld beim Ausbau der Erneuerbaren
Der BUND Naturschutz (BN) hat Versorgung mit Photovoltaik und Windkraft auf regionaler Ebene untersucht und große Unterschiede zwischen den Regionen festgestellt. Besonders die Großstädte und einige ländliche Regionen hinken hinterher. Landkreis Erlangen-Höchstadt gehört zum Mittelfeld.
Bayern hinkt bei der Energiewende im Deutschlandvergleich hinterher, insbesondere der Ausbau der wichtigen Windkraft ist im Freistaat in den letzten Jahren durch die 10h-Abstandsregel fast vollständig zum Erliegen gekommen. Im bundesweiten Vergleich ist Bayern hier Vorletzter in Bezug auf die Landesfläche. Und auch bei der Photovoltaik ist Bayern auf die Fläche bezogen nur auf Platz sieben zu finden. Dabei gibt es innerhalb Bayerns große Unterschiede zwischen den Landkreisen.
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt geht mit gutem Vorbild voran und nimmt im landesweiten Vergleich zwischen 96 Landkreisen und kreisfreien Städten immerhin Platz 38 ein. 33 Prozent des derzeitigen eigenen Gesamtstromverbrauchs werden durch Windenergie und durch Photovoltaik erzeugt. „Aber auch bei uns im Landkreis wird ein weiterer Ausbau der Erneuerbaren Energien benötigt, da sich durch die Elektrifizierung der Wärmeversorgung und von weiten Bereichen des Verkehrssektors der Strombedarf bis 2040 ungefähr verdoppeln wird. Deshalb muss auch Landkreis Erlangen-Höchstadt weiter Photovoltaik und Windkraft voranbringen!“, erklärt Energielotse Wolfgang Schwering der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach.
Der digitale Energie-Atlas der Staatsregierung verdeutlicht die regionalen Unterschiede: Während die Spitzenreiter 120 Prozent ihres Strombedarfs mit Wind- und Solarenergie decken können, hinken die Schlusslichter mit gerade einmal einem Prozent hinterher. Weit abgeschlagen am Tabellenende sind besonders Bayerns Großstädte, aber auch im ländlichen Raum besteht noch enormes Ausbau- und Aufholpotential für eine erfolgreiche Energiewende.
„Nur eine erfolgreiche Energiewende ermöglicht uns, die Klimaziele einzuhalten, garantiert Energieunabhängigkeit von Autokraten und fördert somit Frieden und Freiheit. Und ganz nebenbei sind erneuerbare Energien die kostengünstigsten Quellen und ermöglichen langfristig günstigere Energiepreise für alle!“, unterstreicht Wolfgang Schwering.
Daher fordert die Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des BN einen klaren Plan, wie Landkreis Erlangen-Höchstadt den Ausbau der Erneuerbaren Energien Photovoltaik und Windkraft voranbringen will. Für den BN gehören eine schnellstmögliche Ausweisung von zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft und eine Solarpflicht für allen Neubauten unbedingt dazu. „Lassen Sie uns gemeinsam weiter vorangehen und dabei unsere Energieversorgung sichern und unser Klima schützen!“, so Wolfgang Schwering.
Auch naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sollten weiter ausgebaut werden. Dazu hat eine Arbeitsgruppe aus den BN Kreisgruppen Höchstadt-Herzogenaurach und Erlangen, des Vereins Energiewende ER(H)langen und der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) in ER/ERH im Juni 2022 Ergebnisse ihrer aktuellen Landschaftsraumanalyse zur Identifizierung potenziell geeigneter Fläche vorgestellt.
Für Rückfragen:
Wolfgang Schwering, Energielotse Kreisgruppe, w.schwering@gmx.de
18.11.2022 - Zerstörung eines geschützten Feuchtbiotops
Der BN wehrt sich vehement gegen die Zerstörung eines Feuchtgebietes in der Bachaue am Südrand von Hammerbach. „Hier soll ein Feuchtbiotop zerstört werden, obwohl es günstigere Alternativen für die Baumaßnahmen gäbe“, erklärt der Kreisvorsitzende Helmut König. „Die Feuchtfläche wurde sogar als Biotop entwidmet.“
Bei der Maßnahme handelt es sich um die Verlegung eines unterirdischen Mischwasser-Kanals samt breitem Wirtschaftsweg und Wendehammer durch eine Feuchtfläche in der naturnah entwickelten Aue des Welkenbachs. Bereits Ende 2021 wurde von Horst Eisenack, dem zweiten Vorsitzenden der BN Ortsgruppe, eine erste Stellungnahme an die Stadt Herzogenaurach abgegeben, die mehrere Alternativen und Vorschläge aufzeigte, wie das Feuchtbiotop verschont werden könnte. Diese Vorschläge seien nur oberflächlich beantwortet worden. Gemäß dem ausgelegten Erläuterungsbericht „bietet die Planung nicht einmal einen Ausgleich an und die Biotopwürdigkeit und geschützten Biotope wurden nicht als solche erkannt“, so Eisenack.
Die Kreisgruppe hat hierzu eigens eine fachgutachterliche Einschätzung vornehmen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig: Das Biotop entspreche zwar nicht mehr dem ursprünglichen Biotoptyp einer Nasswiese aus dem Jahr 1985, stelle aber immer noch einen wertvollen Biotopkomplex aus verschiedenen, teils gesetzlich geschützten Feuchtlebensräumen mit einem naturnahen Abschnitt des Welkenbachs dar. Insgesamt habe sich die Biotopfläche seither durch naturnahe Entwicklung sogar vergrößert, da sich der Bachlauf naturnah entwickelt hat und inzwischen sogar vom streng geschützten Biber besiedelt ist. „Die Verkennung der auch aktuell noch gegebenen Biotopwürdigkeit und Ignorierung des gesetzlichen Schutzes von Uferhochstaudenfluren, Großseggenrieden und Auengebüsche stellen einen eklatanten Planungsfehler dar.“ beschreibt Eisenack. Das Mindeste sei, dass die Lebensraum-Zerstörungen korrekt dargestellt und gewürdigt werden, statt Biotope einfach zu negieren. Nötig sei eine Korrektur der Planungsgrundlagen und echte Prüfung der Alternativen. Unvermeidbare Eingriffe müssten durch adäquate Ausgleichsmaßnahmen in der Bachaue kompensiert werden.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
Dr. Horst Eisenack, 2. Ortsvorsitzender Herzogenaurach
17.10.2022 - Flächenfraß stoppen, Energiewende voranbringen
Bei einer Pressefahrt im Raum Höchstadt/Aisch zum Gewerbegebiet Höchstadt-Nord, zum geplanten Baugebiet am Häckersteig und in das Windvorranggebiet bei Lonnerstadt verdeutlichten Vertreter des BUND Naturschutz den dringenden Handlungsbedarf. Sie wurden begleitet vom Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger, Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus der Grünen Landtagsfraktion.
Zwei Herausforderungen stehen in der Umweltpolitik Bayerns an oberster Stelle: Die Klimakrise und der Flächenverbrauch, letzterer ist besonders treibend beim Energieverbrauch und wichtige Ursache des Artensterbens. Beide Themen zeigen sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt derzeit besonders intensiv. Entsprechend erschüttert zeigten sich die Umweltschützer im Norden von Höchstadt/Aisch angesichts des in den letzten Jahren dort gewachsenen Gewerbegebietes Höchstadt-Ost. Es hat eine Fläche von 106 Hektar oder 150 Fußballfelder. Nun sind weitere 35 Hektar vorgesehen.
Der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner erklärte: „Höchstadt an der Aisch ist in der Region besonders ‚gefräßig‘. Die riesigen Flächen, die hier ausgewiesen und vor allem flach und damit besonders flächenverbrauchend bebaut wurden, werden künftigen Generationen bei der Lebensmittelproduktion bitter fehlen. Die Stadt sollte unbedingt flächensparender planen, der neue Flächennutzungsplan wäre eine gute Gelegenheit, um umzusteuern.“
MdL Christian Zwanziger ergänzte: „Der Flächenverbrauch in Bayern ist mit 10,3 Hektar pro Tag ungebremst hoch. Die Staatsregierung verfehlt ihr eigenes Ziel, den Verbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen. Wir brauchen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, die den Kommunen Orientierung liefern und die endliche Ressource Boden für Landwirtschaft, Natur und unsere Erholung schützen.“
Disperse Siedlungen, insbesondere die auf den KFZ-Verkehr ausgerichteten Gewerbegebiete verbrauchen besonders viel Energie. Der Energieverbrauch muss wegen der Klimakrise jedoch dringend reduziert werden. Dazu soll – auch nach dem Willen der Staatsregierung - künftig vorrangig Innenentwicklung betrieben werden. Dies schreibt auch das Baugesetzbuch vor. Trotzdem werden immer wieder große Gewerbegebiete auf der grünen Wiese ausgewiesen.
Helmut König, 1. Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach dazu: „Obwohl längst nicht alle Flächen im Gewerbegebiet bebaut sind und erste Gebäude bereits wieder ungenutzt herumstehen, plante die Stadt ein weiteres Gewerbegebiet am Schwarzenbachgrund. Es wäre völlig falsch, dort weitere Gewerbeflächen anzusiedeln, zumal hier das Grundwasser und eines der besonders wichtigen Kiebitzgebiete gefährdet würden. Nach dem letzten Hochwasser 2021 am Schwarzenbach kamen zwar die Rathausfraktionen zu der Erkenntnis, dass das Planungsbüro ein untaugliches Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan vorgeschlagen hat, nun also ein Ersatz nötig wird. Der neue Standort ist uns noch nicht bekannt.“
Als zweite Station der Tour wurde das von der Stadt geplante Wohnbaugebiet am Häckersteig besichtigt. Hier stieß die Vertreterin der Bürgerbegehren „Rettet den Häckersteig/Schwarzenbachgrund“, Petra Deinlein-Wieland dazu: „Mit dem geplanten Flächennutzungsplan würde der Flächenfraß ausgeweitet. Wir wollen den Flächenverbrauch der Stadt reduzieren und auch langfristig eine in Nordbayern einzigartige Terrassenlandschaft erhalten. Dafür haben wir die Bürgerbegehren gestartet und hoffen auf noch viele weitere Unterstützerinnen und Unterstützer.“ Das Heckengebiet beherbergt auch artenreiche Blühwiesen mit bis zu 200, zum Teil hochgeschützte Pflanzen. "Ein Paradies für Heckenbrüter.“
Zwanziger erklärt: „In der Stadt Höchstadt gibt es zahlreiche bebaubare Grundstücke, die bisher nicht genutzt werden. Statt immer neue Baugebiete im Außenbereich auszuweisen, für die es zusätzliche Infrastruktur – Straßen, Kanalisation usw. – braucht, die auch Geld kostet, sollte mehr Energie in die Aktivierung bisher unbebauter oder leerstehender Grundstücke gesteckt werden. Im Landtag setze ich mich dafür ein, dass Kommunen alle Möglichkeiten bekommen diese Innenentwicklung, die auch der Bayerische Gemeindetag fordert, zu betreiben. Bisher sperrt sich die CSU/FW-Regierung dagegen.“
Zwei Kilometer nördlich des Ortsrandes von Lonnerstadt liegt das ausgewiesene Vorranggebiet für Windkraftanlagen. Mehrere Windräder liefern hier seit Jahren umweltfreundlichen Strom. Mit einem Pilotprojekt zur Kombination Windkraftvorranggebiet und Fotovoltaik könnte Lonnerstadt Geschichte schreiben. „Das gleiche Problem liegt im naheliegenden Mühlhausen vor. Es zeigt sich auch, dass manche Vorschriften zur sinnvollen Standortwahl erneuerbarer Energien überdacht werden müssen“, findet König.
Mergner erklärt dazu: „Der Sommer 2022 war auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein weiterer Extremsommer, die Dürre hat auch hier erbarmungslos zugeschlagen. Damit uns die Klimakrise nicht die Zukunft raubt, müssen wir bei der Energiewende viel besser vorankommen. Wir unterstützen deshalb das Pilotprojekt zur Platzierung von Fotovoltaik-Freiflächen im Windkraftvorranggebiet am Roten Berg nördlich Lonnerstadt.“
MdL Christian Zwanziger: „Wind- und Sonnenstrom vor Ort machen uns unabhängiger und unsere Energieversorgung verlässlicher. Das war schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine wichtig, aber ist jetzt noch drängender. Ich finde klasse, dass Lonnerstadt so sehr auf Erneuerbare Energien setzt. Ich bin froh, dass nun endlich auch das bayerische Wirtschaftsministerium den Weg für eine Doppelnutzung der Fläche für Photovoltaik zusätzlich zur Windkraft frei macht. Entgegen dem, was Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger meinte, gab es nach meiner Kenntnis aus Sicht des Bundesministeriums nie Bedenken oder Einwende, solange die vorrangige Nutzung nicht behindert wird. Das Habeck-Ministerium hat das auch schriftlich klargestellt. Sei es drum. Besser spät als nie.“
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
02.09.2022 - Ausgleichsflächen für Aischtalring überdenken
Der BN hat zur abschließenden Baugebietsplanung zum Aischtalring westlich von Aisch in seiner Stellungnahme gebeten, die Ausgleichsflächen zu überdenken. Abgesehen von der fehlenden Verpflichtung zu Solaranlagen in einem Neubaugebiet lehnen wir die gewählten Ausgleichsflächen für den Verlust von Brutflächen von Kiebitz und Feldlerche im Planungsgebiet ab.
Die Adelsdorfer „Klimaoffensive“ muss das Ziel haben, CO2 zu reduzieren. Aus heutiger Sicht sollte bei Neubaugebieten die Pflicht bestehen, Solaranlagen auf den Gebäuden zu installieren. Die Kosten sind lediglich ein geringer Bruchteil der Baukosten und mittelfristig wird sich die Investition amortisieren.
Eine isolierte Ausgleichsfläche, umgeben von maximal 100 Meter entferntem Wald, Gebüsch und Röhricht wird von Kiebitzen nicht angenommen. Außerdem ist die gewählte Fläche bereits Bestandteil des Moorweiherprogramms und hat bisher trotz naturschutzfachlicher Aufwertung keine Kiebitze angezogen. Daher lehnen wir diese Fläche ab.
Ebenso liegt die Ausgleichsfläche für die Feldlerchen abgeschieden und eingeengt in einer Waldlichtung direkt an der Autobahn A3. Diese Fläche wurde vom BN als PV-Freiflächenanlage vorgeschlagen und im Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Höchstadt wird sie bereits als PV-Sonderfläche ausgewiesen.
Auch die Auslagerung der Ausgleichsflächen in benachbarte Gemeinden sehen wir problematisch, da damit der lokale Artenverlust im Gemeindegebiet gefördert wird.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
15.08.2022 - Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke
Die Kreisgruppen Höchstadt-Herzogenaurach und Erlangen des BUND Naturschutz in Bayern warnen vor unkalkulierbaren Risiken und kritisieren die derzeitigen Diskussionen über einen Streckbetrieb des Niederbayerischen Meilers Isar 2 scharf.
„Der BN hat jahrzehntelang für den Atomausstieg und die Energiewende vor Ort gekämpft, das werden wir jetzt auch verteidigen. Ein Weiterbetrieb ist mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Ich bin fassungslos, dass die bayerische Staatsregierung das Thema jetzt wieder hochkocht, nachdem sie jahrelang die Energiewende behindert hat. Atomenergie muss beendet und die Erneuerbaren massiv gefördert werden“, so der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Erlangen Rainer Hartmann.
Ein Streckbetrieb sei ein Ausstieg aus dem Ausstieg unterstreicht Helmut König, Kreisvorsitzender von Höchstadt-Herzogenaurach: „Ist der Geist erst mal aus der Flasche, besteht die große Gefahr, dass es zu einem allgemeinen Wiedereinstig in die Atomkraft kommt. Dabei ist die Endlagerfrage immer noch nicht geklärt und die Brennstäbe kommen nach wie vor aus Russland und Kasachstan und sind nicht in kurzer Zeit verfügbar. Außerdem bestehe die Gefahr, dass aufgrund der schlechten Regelbarkeit der Kernkraftwerke die Erneuerbaren wieder abgeschaltet werden müssten und Geld in eine auslaufende Technologie auf Kosten der Steuerzahler investiert wird.“
Außerdem empfehle der BN seit Jahren die Prioritätsreihung „Energie sparen – Effizienz erhöhen – Erneuerbare nutzen“. Gerade beim Sparen seien noch viele Potentiale vorhanden. Hier sollte die Bayerische Staatsregierung ein umfangreiches Energiesparprogramm auflegen. Auch Stadt und Landkreis könnten hier mehr Aufklärung betreiben.
Alfons Zimmermann, Physiker im Vorstand der KG Höchstadt-Herzogenaurach ärgert sich über die falschen und populistischen Aussagen Söders. „Bayern ist keinesfalls an der Spitze der erneuerbaren Energien, wie behauptet. Es kommt auf den Flächenertrag an. Und da liegt Bayern trotz ausgebauter Wasserkraft lediglich im bundesweiten Mittelfeld. Das wäre so, wie wenn ein Großbauer stolz verkündete, dass er mit 200 Hektar deutlich mehr erntet als ein Kleinbauer mit 20 Hektar.“
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
28.06.2022 - Potenzialanalyse für naturverträgliche Photovoltaik- Freiflächenanlagen

Eine Arbeitsgruppe aus den BUND Naturschutz (BN) KreisgruppenErlangen und Höchstadt-Herzogenaurach, des Vereins Energiewende ER(H)langen und der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) in ER/ERH hat am Freitag den 24.6.2022 im Landratsamt Erlangen-Höchstadt im Rahmen einer Bürgermeisterdienstbesprechung die Ergebnisse ihrer aktuellen Landschaftsraumanalyse zur Identifizierung potenziell geeigneter Flächen für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) vorgestellt.
Stefan Jessenberger, Vorsitzender des Vereins Energiewende ER(H)langen, erläuterte, wie wichtig konsequentes und rasches Handeln nun sei, um Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in der Energieversorgung zu wahren sowie Klimaziele und Unabhängigkeit von Drittstaaten zu erreichen. Die derzeit rasant steigenden Energiekosten infolge der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern erforderten einen stark beschleunigten Zubau erneuerbarer Energien. Sonne und Wind hätten noch ein erhebliches Ausbaupotenzial und ergänzten sich gut. Zwar seien insbesondere Dach- und PKW-Stellflächen sowie Gebäudefassaden prädestiniert für den Einsatz der Photovoltaik (PV). Allerdings sei in den vergangenen Jahrzehnten der Ausbau nicht im nötigen Tempo erfolgt und Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand seien langwierig, kleinteilig und wesentlich teurer als relativ schnell und kostengünstig zu errichtende PV-FFA.
Daher komme gerade im sonnenreichen Bayern dem Ausbau der Photovoltaik auch im Freiland große Bedeutung zu. Nach einer aktuellen Studie der Technischen Universität München sind zur Erreichung der Klimaziele, zusätzlich zu PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden, PV-FFA auf 2-3 Prozent der Landesfläche notwendig. Diese könnten z. T. auch in Form von Agri-PV-Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung kombiniert werden, so dass langfristig verlässliche Erträge aus Solarkraftwerken sowohl Eigentümern und Betreibern, als auch Kommunen und Landwirten zukämen. Der oft kritisierte Flächenbedarf für PV-FFA nimmt sich gegenüber den aktuell 14 Prozent der Ackerflächen für „Bio“-Kraftstoffe und 60 Prozent für den Anbau von Futtermitteln in Deutschland bescheiden aus. Gegenüber „Bio“-Kraftstoffen könne mit PV auf derselben Fläche das 30-fache an Energie gewonnen werden.
Den beteiligten Naturschutzverbänden sei es wichtig, sich frühzeitig konstruktiv und beratend einzubringen. Ziel sei es, die Akzeptanz für PV-FFA zu erhöhen und rasch konfliktarme, naturverträgliche Photovoltaik-Projekte zu ermöglichen.
Harald Schott, Kreisvorstandsmitglied im BN und LBV-Mitglied stellte den aktuellen Stand der Auswertungen der Flächensuche dar. Im Stadtgebiet Erlangen und im Landkreis ERH konnte die Arbeitsgruppe bislang naturschutzfachlich geeignete Teilflächen von insgesamt 1422 ha identifizieren (1200 ha davon im Landkreis ERH), was ca. 2,2% der Fläche von Stadt Erlangen und Landkreis ERH ausmacht. Weitere Analysen erfolgen sobald die entsprechenden Kommunen Interesse an den Analysen zeigen.
Grundsätzlich sollten möglichst bereits vorbelastete Bereiche für die Errichtung von PV-FFA ausgewählt werden. Hierzu zählen z. B. stark verlärmte Zonen entlang der Autobahn, aber auch fragmentierte „Restflächen“ zwischen Verkehrswegen und Gewerbeflächen. Günstig wäre auch eine Konzentration von PV-Anlagen in der Nähe bestehender Windräder, soweit diese den Betrieb bestehender und Bau künftiger Windkraftanlagen in Vorranggebieten nicht einschränkten. Hierdurch könnten ggfs. Kollisionsrisiken für Großvögel reduziert werden. Leider würde eine solche Doppelnutzung von Windkraft-Vorranggebieten bislang behördlich pauschal ausgeschlossen, worauf aus eigener Erfahrung auch die Bürgermeister Faatz (Mühlhausen) und Brehm (Höchstadt) hinwiesen. Die Arbeitsgruppe hat angeboten, sich gerne in die aktuell hierzu laufende Diskussion der zwangsweise einzuhaltenden Abstände von PV-Anlagen zu Windvorranggebieten fachlich einzubringen.
Die Arbeitsgruppe stellte zudem fest, dass die meisten Schutzgebiete, Wälder sowie Lebensräume stark gefährdeter sensibler Feldvögel wie Kiebitz ungeeignet für den Bau von PV-FFA seien. Hierdurch kann auch die Notwendigkeit zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen, die bei Betroffenheit dieser Arten nötig wären, minimiert werden. Andererseits können andere Tierarten von PV-FFA profitieren, da auf den zuvor oft intensiv bewirtschafteten Flächen dann keine Pestizide oder Dünger mehr ausgebracht würden und die Flächenpflege und Gestaltung in gewissem Rahmen auch gezielt an die Bedürfnisse gefährdeter Arten angepasst werden kann.
Als Unterstützer der Energiewende bieten die beteiligten Vereine des Arbeitskreises interessierten Kommunen ihre fachliche Expertise, Gebietskenntnis sowie akzeptanzfördernde Öffentlichkeitsarbeit an.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
13.05.2022 - Fakten gegen die Südumfahrung
In welcher Welt leben wir eigentlich!
Die Wissenschaft wie auch die große Politik erklären uns eindringlich unseren Verkehr zu reduzieren. Die Gründe sind hinlänglich bekannt (Details siehe unten unter Fakten gegen die Südumfahrung). In der Metropolregion Nürnberg, dem zweitgrößten Verkehrsverbund in Bayern, fällt den Lokalpolitikern von CSU und SPD nichts anderes ein, als noch mehr Verkehr zu fördern. Alternativen werden weggewischt, vielfältige Maßnahmen bleiben ein Fremdwort, Naturverbrauch ist und bleibt am günstigsten.
Hier wird nur eins umfahren – die Verkehrswende. Individualverkehr verhindert den Umstieg auf ÖPNV. Die Straße wird zum Einfallstor und belastet Herzogenaurach in der Zukunft erst recht.
Wir ernten, was wir säen – und das sollten Nahrungsmittel sein. Die Straße zerstört Felder, reduziert Erträge und frisst die Fläche mehrerer kleiner landwirtschaftlicher Betriebe – insgesamt sogar 44,7 ha (Nachzulesen im Erläuterungsbericht des Planfeststellungsverfahrens unter Berücksichtigung der Ökokonten, die auch Fläche beanspruchen).
Lasst uns endlich handeln!
Anstelle der monströsen Straße sollte in den ÖPNV, die Aurachtalbahn und StUB zusammen mit innovativen Lösungen für den Verkehr generell, dem Transport von Lasten, dem Umbau und der Lenkung von Verkehrsströmen, dem Ausbau von Rad- und Fußwegen investiert werden. Mit einer 30 km/h Zone könnte Niederndorf sofort entlastet werden. Preiswerte getaktete Buslinien, Routenänderungen, Mitfahrgelegenheiten u.a. entlasten alle.
- Stimmen Sie für das Bürgerbegehren STOPP SÜDUMFAHRUNG
Fakten gegen die Südumfahrung
Alle Daten stammen aus den Unterlagen der bisherigen Bauleitverfahren, aus den Bundesbehörden, der Bayerischen Staatsregierung, der Industrie und der Stadt Herzogenaurach.
Die Pendler-Situation
Wir haben 17.000 motorisierte Ein- und Auspendler, die ca. 50.000 t CO2 pro Jahr produzieren. Um das zu kompensieren bräuchte man einen ausgewachsenen Wald von einer Fläche der Größe der kommunalen Fläche Herzogenaurachs. Elektroautos helfen leider nicht. Es ist bedrückend und man merkt, dass wir mit dem individuellen motorisierten Personenverkehr nicht mehr so weiter machen können.
Belastung durch den Bau der geplanten Südumfahrung
Die größten CO2-Belastungen gehen von der Zement- und Stahl-Erzeugung aus. Über 8.000 t CO2 Belastung erzeugt der Bau, das entspricht etwa dem tausendfachen CO2-Fußabdruck eines Herzogenaurachers. Die Herzogenauracher CO2-Ziele sind Makulatur. Für den Bau müssen die Bürger ca. 14.000 Schwerlastfahrten erdulden, vor allem, um die riesigen Aushubmassen zu verschieben. Der sehr tiefe Einschnitt am Galgenhof liegt da an der Spitze.
Herzogenaurachs aktueller Flächenverbrauch ist schon zweimal höher als die bayerischen Flächenziele. Für Herzogenaurach umgerechnet ist der erforderliche Ziel-Wert bei 1,2 ha pro Jahr. Mit 8 ha Versiegelung und insgesamt 44,7 ha benötigter Fläche ist unser Verbrauchs-Budget auf auf mehr als 26 Jahre allein durch die Südumfahrung ausgeschöpft. Das Flächenverbrauchs-Ziel wird massiv verfehlt.
Die in Mittelfranken und bei uns ausgeprägte Trockenheit wird weiter unterstützt durch die schnelle Entwässerung von Feldfluren, Einschnitten und Trassen mit eingeleiteten Schadstoffen über Biotope in die Aurach. Regenwasser aufzuhalten wird verfehlt, denn Versickerungsanlagen sind nicht vorgesehen. Ein Schwammstadt-Konzept ist nicht auszumachen.
Die Natur wird vor Ort unwiederbringlich zerstört. Landschaftsschutzgebiete werden zu 38 % durchschnitten. Ausgleichsmaßnahmen sind Augenwischerei. Hochgefährdete Tiere können nicht ausgeglichen werden - das schaffen wir nicht mal mehr in unseren Naturschutzgebieten! Das Ziel, die Natur zu erhalten, wird verfehlt.
Landwirte leiden unter zerschnittenen Äckern und an massiven Landverlust. Ebenso die Naherholung. Das Ziel eines wirtschaftlichen Ackerbaus und ein besseres Angebot der Naherholung ist nicht gegeben.
Belastungen durch die geplante Südumfahrung
Niederndorf verkehrsmäßig zu entlasten, ist der Hauptgrund für die Südumfahrung. Es wird allerdings nicht wahrgenommen, dass durch die Südumfahrung mehr Verkehrs- und Lärmverlagerung in anderen Ortsteilen stattfinden werden. So wird z. B. in der Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Str. oder im Schützengraben der Verkehr durch die Südumfahrung erheblich gesteigert. Gemäß der Prognose für 2035 im Vergleich mit und ohne Südumfahrung, ergibt sich dort für KFZ über 60 % und für LKW über 170 % mehr Verkehr. Dort wohnen mehr Bewohner als in der Niederndorfer Hauptstraße. Ausserdem sind die alten Prognosen nicht mehr aktuell und der Zeit angepasst.
Das Klima-Ziel, den Verkehr um 50 % gegenüber heute zu reduzieren, gilt lokal für die Vacher Kreuzung aber nicht für die, durch die Südumfahrung vermeintlich anderen bevorzugten Siedlungsstraßen und schon gar nicht für die Südumfahrung selbst. In Hauptendorf und Neuses entstehen neue Verkehrsbelastungen durch die hohen Brücken.
Die Südumfahrung ist keine Stadtumfahrung, sondern endet im Zentrum und ist ein weiteres Einfallstor für den Verkehr. Das ist dann in Zukunft unser nächstes Problem mit Autostaus in der Innenstadt. Statt Niederndorf wird der Postkreisel mit Umgebung das neue Stau-Zentrum. Ohne neue Verkehrs-Konzepte wird eine Highway-Südumfahrungs-Einflugschneise mitten durch die Innenstadt zur Nordumgehung notwendig sein. Wollen wir das?
Ein weiterer Punkt: Herzogenaurach würde von zwei Umfahrungen eingekesselt, die Naherholung beeinträchtigt und weitere Bau- und Gewerbe-Ansiedlungen fördert. Wollen wir das?
Für den Verkehr durch die geplante Südumfahrung wurden vom BN sehr detaillierte Berechnungen durchgeführt, die auch Bestandteil der Einwendung zum Planfeststellungsverfahren sind. Die Strecke von West nach Ost ist 2 km länger und benötigt 1 Minute mehr Zeit, trotz höheren Geschwindigkeiten auf der Südumfahrung, die 5 Ampeln auf der Stecke nicht mit eingerechnet. Die Verkehrs-Ströme zwischen O, W, N, S und SO, sonst über das Vacher Kreuz in Niederndorf, ergeben mehr Verkehr über die geplante Südumfahrung. Das sind 44% mehr Kilometer und 10 % mehr Fahrzeit. Ein Fahrzeit-Nutzen fehlt da. Es ist zu befürchten, dass die teure Südumfahrung nicht angenommen wird und sich viel Schleichverkehr durch die Stadteile ergießen werden.
Insgesamt ergibt sich eine zusätzliche Belastung von 3.400 t CO2 pro Jahr. Eine Wald-Kompensation benötigt hier die doppelte Fläche zwischen der Südumfahrungs-Trasse und der Aurach. Herzogenaurachs Ziel, die CO2-Belastung bis 2030 auf 50 % und danach auf 90 % zu reduzieren wird damit voll verfehlt.
Mit den Baukosten von 75 Mio. €, den Unterhaltskosten und den zusätzlichen volkswirtschaftlichen Kosten durch mehr Kilometer und Zeit auf der Südumfahrung ergibt sich kein finanzieller Nutzen. Der Nutzen/Kosten-Faktor ist damit nahezu Null. Bei der StUB wird für die Förderung ein Faktor von Eins verlangt. Wieso gilt das für die geplante Südumfahrung nicht?
Kurze Zusammenfassung
Die gewünschten Ziele werden also verfehlt, wenn wir die Südumfahrung bauen. Diese sind: CO2-Reduzierung, Verkehrs-Reduzierung, Flächenverbrauch, wirtschaftlicher Ackerbau, Regenwasser-Rückhaltung, Schützen der Natur, Fördern der Naherholung. Im Zentrum ist der nächste Stau eingeplant. Warum soll die Straße überhaupt gebaut werden, da nach einer neutralen Berechnung die Kosten den Nutzen nicht rechtfertigen? Schon die Nordumgehung hat gezeigt, dass die Entlastung einer neuen Umgehungsstraße nicht von Dauer ist.
Für Herzogenaurach liegen von uns viele alternative Vorschläge vor, die allen helfen. In anderen Städten werden Straßen zurückgebaut und Parkplätze umgewidmet. Wie soll es denn weitergehen, wenn wir hauptsächlich den PKW-Verkehr bevorzugen? Wir nehmen uns die Chance für einen wirklich klima-notwendigen Ausbau des ÖPNV und neuer Mobilitätskonzepte. Aurachtalbahn, StUB, Busse, P&R, Lieferung mit MobilHubs, Fahrradwege, Mitfahrgelegenheiten, Verkehrsberuhigung, Fußgängerwege sind hier die Stichworte. Herzogenaurach könnte Vorreiter in der Region werden, nur Mut!
07.02.2022 – Anmerkungen zum Start Bürgerentscheid Südumfahrung
BN-Standpunkt
Die Sprecherin der Aktionsgemeinschaft "Stopp Südumfahrung", Professorin Martine Herpers überreichte kürzlich die gesammelten Listen des Bürgerbegehrens an die Stadt Herzogenaurach. Neben dem BN gehören weitere neun Vereine, Verbände und Parteien dieser Gemeinschaft an. Zwischenzeitlich wurde von der Herzogenauracher Verwaltung bestätigt, dass dem Einstieg in den Bürgerentscheid nichts mehr entgegensteht. Von den 1942 Unterzeichnern wurden 1733 als gültig festgestellt. Wir sind uns sicher, dass ohne Pandemie erheblich mehr Leute gegen eine weitere naturzerstörende Straße erreicht worden wären.
Für den BN ist es unverständlich, dass trotz gravierenden Klimaproblemen immer noch nach mehr Straßen, anstatt nach zukunftsweisenden Lösungen in der Stadtratsmehrheit gesucht wird. Man beharrt auf den Vorstellungen des letzten Jahrhunderts und verpasst dabei das Umdenken hinsichtlich der inzwischen erkannten Probleme. Gerade die Haltung der lokalen SPD irritiert, da sie sich immer weiter von der Meinung der neuen Regierung entfernt.
Vor Jahren, als die ersten Diskussionen im Stadtrat zur Entlastung der Niederndorfer entlang der Straße aufkamen, war wohl das Ziel, dies so kostengünstig wie möglich zu machen. Heute müsste man aber erkennen, dass die Bedrohung unserer Kinder und Enkelkinder durch Klimawandel und Artenverlust eine geänderte Bewertung bedürfen. Natur wurde und wird auch heute noch als untergeordnet betrachtet.
Durch mehrere wissenschaftliche Vorträge, wegen der Pandemie online realisiert, versuchen wir die Bevölkerung aufzurütteln. Wir müssen aber feststellen, dass gerade Entscheider aus dem Stadtrat sich nicht besonders dafür interessieren. Man hat eben immer noch seine vorgefertigte Meinung.
Besonders bedrückt uns, dass etliche Leute uns verunglimpfen und der Lüge beschuldigen. Plakativ wird uns immer wieder vorgehalten, dass wir die Planungsunterlagen nicht kennen. Hier müssen wir entgegenhalten, dass gerade diese sehr detailliert von uns durchgearbeitet wurden, sonst wären Stellungnahmen von bisher insgesamt 115 Seiten nicht möglich gewesen. Wir haben dabei den Vorteil, dass wir einen Gesamtüberblick über die Verkehrs- wie Natursituation im Landkreis als Vergleich haben.
Unserer Meinung nach hängt alles am politischen Willen, welche Lösung realisierbar ist. Die Aurachtalbahn ist dabei ein Beispiel. Jahrelang wurde eine Machbarkeitsstudie abgelehnt, um ja nicht die Wünsche der Stadtratsmehrheit zu beschädigen, Streckenabschnitte wurden entwidmet. Heute bröckelt diese Einstellung, denn die Aussage des Bürgermeisters, dass alles rein technisch nicht machbar ist, scheint so wohl nicht zu stimmen.
Nun plant man zusätzlich ein Ratsbegehren, das man entgegenstellen kann. Aber was erreicht man dadurch? Man stimmt einfach die bestehende Frage mit Ja oder mit Nein ab. Wozu also eine zweite, lediglich konträre Frage. Voraussichtlich wird noch eine dritte Frage dazukommen, um alles nur nicht bürgerfreundlicher zu machen.
Helmut König, 1. Vorsitzender
01.02.2022 - Herzogenaurachs Klimaschutzziele werden haushoch verfehlt
Energy Award nicht aussagekräftig
Johannes Kollinger, langjähriger Sprecher der Agenda-21-Gruppen in Herzogenaurach und stellvertretender Vorsitzender des Energiewendevereins ER(H)langen, analysierte den Stand des Klimaschutzes in Herzogenaurach und was der European Energy Award (EEA) der Stadt wirklich gebracht hat. Dazu wurde er vom Bündnis Stopp-Südumfahrung zu einem Online-Vortrag eingeladen.
Er stellte fest, dass es gut ist, wenn Herzogenaurach Maßnahmen zum Klimaschutz ergreift, „Jedoch werden die gesetzten Ziele des Stadtrats haushoch verfehlt, trotz Gold, mit dem die Stadt ausgezeichnet wurde“. Die ergriffenen Maßnahmen haben weder bei Strom und Wärme, noch beim Verkehr zu einer nennenswerten Reduktion der CO2-Emissionen geführt.
„Teilweise werden sogar Maßnahmen ergriffen, die zu einer Steigerung führen, wie die Erdgasversorgung am Behälterberg oder der geplante Bau der Südumfahrung“ stellte er fest. „Der EEA bildet nicht ab, was an CO2 zusätzlich erzeugt wird, und das ist bei der Südumfahrung eine erhebliche Menge.“
In jedem Bereich steckt noch ein riesiges Verbesserungspotential. Die Stromerzeugung mit PV-Anlagen könnte vervierfacht werden. Wärme wird immer noch zu über 80% mit Öl und Gas erzeugt. Hier sind Sanierungen im Bestandsbau, Umstellung auf Wärmepumpen und auf Fernwärme mit regenerativen Energien enorm wichtig. Bei der Mobilität fordert er einen Ausbau der Radwege-Infrastruktur, der seit 2017 nahe Null ist, einen massiven Ausbau des ÖPNV und eine notwendige Reduzierung des Individualverkehrs.
In der anschließenden Diskussionsrunde wurde vom Bund Naturschutz aufgezeigt, dass die motorisierten Pendler alleine eine jährliche CO2-Belastung erzeugen, wofür ein 100-jähriger Wald in der Größe des gesamten Stadtgebietes zur Kompensation notwendig wäre. „Der geplante Bau der Südumfahrung passt nicht zu den gesetzlichen und selbst gesteckten CO2-Zielen der Stadt und muss gestoppt werden.
Stattdessen ist unter Beachtung der CO2-Reduzierung ein regionales Gesamtverkehrskonzept zum Nutzen aller Herzogenauracher zu erstellen“, bestätigte Kollinger.
Um das 1,5 Grad Ziel von Paris zu erreichen, ist das CO2-Budget bereits in 5,4 Jahren verbraucht, stellt die Stadtverwaltung selber fest. Daher appellierte Kollinger an die Stadt „dass alle Entscheidungen hinsichtlich der Auswirkungen auf Klima und Umwelt mit einem geeigneten Monitoring-System bewertet und bilanziert werden.“
Rückfragen:
Prof. Dr. Martine Herpers, Sprecherin Stopp Südumfahrung
für den BN: Helmut König, 1. Vorsitzender
15.11.2021 - Jahreshauptversammlung 2021
11.10.2021 - Offener Brief an Landrat Tritthart
25.05.2021 - BN Stellungnahme zum Vorentwurf des FNP Höchstadt
19.04.2021 - Pressemitteilung zur Stellungnahme Südumfahrung Niederndorf-Neuses
29.03.2021 - Flächennutzungsplan Höchstadt weist massiv Flächen aus
08.03.2021 - Bebauungsplan Aischtalring in Aisch
15.11.2021 - Jahreshauptversammlung 2021
für die Jahre 2019 und 2020
Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Jahreshauptversammlung 2020 fand am 15.11.2021 nun die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe im Gasthaus „Zur Sonne“ in Lonnerstadt für die beiden letzten Jahre statt. Wieder unter erschwerten Bedingungen (2G), was die Teilnahme stark beeinträchtigte.
Gleich zu Beginn erinnerte der Kreisvorsitzende Helmut König an die verstorbenen Mitglieder, darunter auch sein Vorgänger Siegfried Liepelt, der die Kreisgruppe jahrzehntelang intensiv mitgestaltete. Die Mitgliederzahl hat sich seit 2019 auf 1.538 leicht verringert.
Intern wurde die Kassenabrechnung neu organisiert und für die Amphibienabrechnung ein umfangreiches Tool erstellt. Die beiden Rammlerweiher im Naturschutzgebiet (NSG) Mohrhof, die nach 50 Jahren wieder reaktiviert wurden, haben sich gut entwickelt, wie eine Untersuchung des IVL-Instituts im Auftrag der Regierung bestätigte. Neben Limikolen (z.B. Flussufer-, Waldwasserläufer, Bekassinen u.a.) wurde auch ein Laichkraut entdeckt, das seit 100 Jahren in Bayern nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Auch die neu ausgeschobene „Blaue Lagune“ am Blätterweiher hat sich zum idealen Platz für Amphibien, Libellen und Rallen entwickelt.
Seit mehr als zwei Jahren plant die Kreisgruppe einen Vogelbeobachtungsturm im NSG Mohrhof. Zeitraubend war vor allem die Standortsuche. Trotz Pflichtenheft haben aufgrund steigender Stahl- und Holzpreise zwei Planungsbüros ihre Kalkulationen zurückgezogen. Man hat nun den Start auf später verschoben. Auch die Zuschüsse müssen neu geregelt werden.
Alfons Zimmermann stellte die umfangreichen Biotoparbeiten im NSG Mohrhof vor.
Mitte Oktober wurde der letzte der BN-Weiher (Blätterweiher) abgefischt. Wie immer unter umfangreicher Hilfe unterstützender Teichwirte. „Auch haben Fachleute wieder nach Schlammpeitzgern gesucht“, so König, „die teilweise zur Nachzucht an Weihenstephan abgegeben werden.“
„Ein besonderer Dank ergeht an unsere Amphibiensammler, die mit viel Aufwand leider immer weniger Amphibien verzeichnen“, wird bedauert. Besonders an Erdkröten ist ein kontinuierlicher Rückgang seit Jahren feststellbar. „Auch durchschneidet die Südumfahrung bei Herzogenaurach mehrere Wanderwege, deren Amphibienzahl fast an alle bisher 11 betreuten Übergänge im Landkreis heranreicht“, erklärt König und hofft, dass die Natur dort mehr Beachtung findet.
Im Projekt „Hilfe für Kiebitze“ wurde festgestellt, dass die Verlagerung von Ausgleichsmaßnahmen aus der Aischaue durch Höchstadt nach Förtschwind nicht wirklich erfolgreich ist. Für König mit ein Grund zur Ablehnung des neuen Flächennutzungsplans der Stadt. Dazu führt er einen Vergleich mit Herzogenaurach und Adelsdorf an. Bezugnehmend auf das gesetzte Ziel der Regierungskoalition von CSU und FW, den Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag zu begrenzen, überschreitet Höchstadt dieses um das Fünffache. „Höchstadt sollte sich dringend Gedanken über ein effektives Flächenmanagement machen“, empfiehlt der Kreisvorsitzende.
Als Träger Öffentlicher Belange wurden auch etliche Stellungnahmen abgegeben, so zu den Flächennutzungsplänen Adelsdorfs und Höchstadts oder zu Bebauungsplänen wie „Süd im Sand“ in Röttenbach oder zur PV-Anlage im Vogelschutzgebiet bei Neuhaus. Auch Podiumsdiskussionen und hochkarätige Informationsveranstaltungen wurden durchgeführt.
Zum Schluss gab es noch einen Appell an die Kommunen, mehr auf die Gesetzgebung im Naturschutz zu achten. „Es muss Aufgabe der Bürgermeister sein, Gemeindearbeitern die Gesetzeslage zu erläutern, und nicht Verstöße auf die Mitarbeiter zu schieben.“ Die Entschuldigung der Betroffenen wurde angenommen, die Beobachtung bleibt aber bestehen.
Danach stellten die einzelnen Ortsgruppen in Kurzberichten ihre umfangreichen Aktivitäten dar. Darunter die Bürgerbegehren in Herzogenaurach und Höchstadt und der Badweiher in Weisendorf.
Zum Abschluss wurden dann von Marlis Liepelt die Jahresabrechnungen der Kreisgruppe für die Jahre 2019 und 2020 vorgestellt. Die Kassenprüfung von Georg Brugger wurde als ordentlich bestätigt. Der Kreisvorstand wurde einstimmig entlastet.
Für Rückfragen:
Helmut König, 1. Vorsitzender
11.10.2021 - Offener Brief an Landrat Tritthart
CO2-Emissionen im Landkreis signifikant senken
In einem offenen Brief an Landrat Alexander Tritthart, und seinen Stellvertretern/Stellvertreterinnen sowie Kreisrätinnen und Kreisräte fordern wir ein verstärktes Handeln für den Klimaschutz. Über eine entsprechende Berichterstattung hierzu würden wir uns sehr freuen.
Sehr geehrter Herr Landrat Tritthart,
sehr geehrte Frau stellvertretende Landrätin Klaußner, sehr geehrter Herr stellvertretender Landrat Dr. Oberle, sehr geehrter Herr stellvertretender Landrat Bachmayer, sehr geehrte Kreisrätinnen und Kreisräte, die katastrophalen Unwetter-Ereignisse im Juli dieses Jahres in Rhein-Land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben es uns eindrücklich vor Augen geführt: Auch in Deutschland ist der Klimawandel mittlerweile mit einer Heftigkeit angekommen, wie wir es in der Vergangenheit nur von Bildern aus dem Ausland kannten.
Mehr als 170 Tote sind nun auch in Deutschland zu beklagen. Auch in Deutschland werden Menschen zu Klimaflüchtlingen, da sie ihre Häuser und Wohnungen oder das was davon übriggeblieben ist, nicht mehr an Ort und Stelle aufbauen können, weil der Ortsteil oder Straßenzug nicht dauerhaft vor solchen Starkregenereignissen geschützt werden kann. Und auch in Höchstadt und Adelsdorf waren in diesem Jahr ebenfalls wieder Hochwasserschäden zu beklagen. Hinzu kommen die verheerenden Brände in Südeuropa, Nordamerika und Russland sowie erneute weltweite Hitzerekorde. Hitze, die indirekt vor allem älteren Menschen vorzeitig das Leben kostet.
Somit sollten mittlerweile auch die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass ein unverzügliches und konsequentes Umsteuern in allen Sektoren und auf allen Ebenen zwingend notwendig ist. Die Erfolge in der Vergangenheit und die bisherige Geschwindigkeit begonnener Transformationsprozesse reichen leider nicht aus, um uns auf einen noch einigermaßen verträglichen 1,5 °C Kurs zu bringen.
Wissenschaftlich fundierte Projektionen gehen auf Basis der derzeit beschlossenen Klimaschutz-Programme aktuell von einer Temperaturerhöhung von 2,7 - 3,1 °C bis Ende dieses Jahrhunderts aus (Quelle: bit.ly/3heX8ha).
Das hätte zur Konsequenz, dass viele Regionen dieser Erde nicht mehr bewohnbar wären und die Kosten für durch den Klimawandel bedingte Schutz- und Anpassungsmaßnahmen in den verbleibenden Regionen ins Uferlose steigen würden. Namhafte Rückversicherer wie die Munich Re oder die Swiss Re warnen seit Jahren vor weiter steigenden Schadenskosten und betonen, dass vorbeugender Klimaschutz günstiger ist als die spätere Schadensbehebung (siehe bit.ly/2Xbp4eX).
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat ermittelt, dass Deutschland noch ein CO2-Restbudget von 4,2 Gt verbleibt, um seinen Anteil dazu beizutragen, damit das 1,5°-Ziel mit 66% Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann (Quelle: bit.ly/3yTUaVf)
Bei dem derzeitigen deutschen Emissionsniveau von 0,7 Milliarden t CO2 wird dieses Budget bereits im Jahre 2026 aufgebraucht sein. Es muss Aufgabe der Klimaschutzpolitik in den Gebietskörperschaften sein, dieses Budget durch substantielle jährliche Senkung der CO2-Emissionen auf einen möglichst langen Zeitraum auszudehnen.
Keine Kommune, kein Landkreis, kein Bundesland sollte sich hierbei auf andere verlassen. Bestehende rechtliche Rahmenbedingungen und Förderprogramme müssen vollumfänglich genutzt werden.
Dort wo es Hemmnisse gibt, muss die Beseitigung dieser über den Landkreistag und andere politische Wege auf Landes- und Bundesebene eingefordert werden.
Wir möchten Sie daher eindringlich bitten, die verbleibenden vier Jahre Ihrer Legislaturperiode konsequent zu nutzen, die CO2-Emissionen im Landkreis Erlangen-Höchstadt signifikant zu senken sowie die Basis für die Klimaneutralität im Landkreis zu legen.
Nutzen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsam mit den Kommunen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen, Organisationen und Institutionen des Landkreises und umliegender Kommunen. Die Wählerinnen und Wähler haben Ihnen hierzu – unabhängig von der Parteizugehörigkeit – im Rahmen der Daseinsvorsorge den Auftrag und das Mandat erteilt.
Der Landkreis kann, wie bereits in der Vergangenheit z. B. dem ÖPNV oder Radverkehr bewiesen, bei entsprechendem Willen interkommunale Lenkungsfunktion übernehmen, Maßnahmen und Projekte auf Kreisebene initiieren und umsetzen oder kommunale Maßnahmen unterstützen.
Konkret möchten wir Ihnen Folgendes vorschlagen bzw. Sie um Folgendes bitten:
Setzen Sie sich zum Ziel, dass sich der Landkreis bis spätestens 2030 zu 100% mit regenerativen Energien bilanziell selbst versorgen kann. Beauftragen und steuern Sie hierfür die Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes in Kooperation mit den Kommunen u. a. über einen landkreisweiten Energienutzungsplan mit daran anschließender proaktiver Projektentwicklung durch die Kommunen.
Hierfür empfehlen wir entweder die Gründung einer kreiseigenen Energie- und Klimaschutz-Agentur oder den Aufbau eines eigenständigen Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit innerhalb des LRA, welche(s) die Kommunen bei der Planung, der Vergabe und der Umsetzung von Projekten unterstützen kann, so dass diese(s) im avisierten Zeitrahmen und unter Nutzung von kostensenkenden Synergiepotentialen erfolgen kann.
Setzen Sie sich zum Ziel, die energetische Sanierungsrate von Bestandsbauten und deren Heizungssystemen im Landkreis durch eine breit aufgestellte Energieberatung unter Nutzung staatlicher Förderprogramme bis Ende 2026 auf 2,5% der vorhandenen Bestandsbauten (derzeit 1%) und bis 2030 auf jährlich 4% zu erhöhen.
Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen. Diese sollen mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um Einzelberatungen sowie Beratungen für Kommunen, z. B. für die Planung und Durchführung von Konvoi-Sanierungen anbieten zu können. Zudem ist hierfür auch eine stärkere Ausrichtung der Wirtschaftsförderung auf „grüne Berufe“, also im SHK- Handwerk, der Gebäudeenergietechnik, dem Bau-/Dämmgewerbe und der Solarenergie zu organisieren.
Setzen Sie sich zum Ziel, dass klimaneutrale Gebäude bei jeglichen Neubauten im Landkreisgebiet – im Bestfall unter Nutzung nachgewiesen nachhaltig nachwachsender Rohstoffe – bis 2030 zum Standard werden und die Flächeneffizienz beim Bauen durch höheres Bauen erhöht wird sowie in Summe weniger Flächen ausgewiesen werden. Das mindert die fortschreitende Versiegelung und setzt Personalkapazitäten im Baugewerbe für Sanierungsmaßnahmen frei.
Gehen Sie als Landkreis beim klimaneutralen Bauen auch selbst mit positivem Beispiel voran: Lassen Sie kreiseigene Liegenschaften zu „Effizienzhäusern“ sanieren, um ressourcenintensive Ersatzneubauten zu vermeiden; setzen Sie im Fall von Neubauten ab sofort auf höchste Energieeffizienz, 100% erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe, indem bei Neubauten Passivhausqualität oder die Auszeichnung „Platin“ der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen realisiert wird.
Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen, die mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um gezielte Beratung Architekt:innen und Bauwilligen anzubieten und die Kommunen bei der Aufstellung entsprechender Bebauungspläne und Satzungen unterstützen zu können.
Setzen Sie sich zum Ziel, dass der Ökolandbau im Landkreis signifikant ausgebaut und die Tierbestandszahlen schrittweise deutlich gesenkt werden.
Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen, die mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um gezielte Beratung für Landwirt:innen anbieten zu können.
Fassen Sie den Beschluss, dass der Landkreis dem Verein „Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Nürnberg beitritt.
Dieser hat zum Ziel, zusätzliche Mittel für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen für den Klimaschutz und die nachhaltige Entwicklung in der Metropolregion zu generieren. Dadurch wir die schnellere Erreichung der Klimaschutzziele der Kommunen der Metropolregion unterstützt.
Weitere Infos dazu hier: bit.ly/3yY82xV
Setzen Sie sich zum Ziel, dass klimaneutrale Gebäude bei jeglichen Neubauten im Landkreisgebiet – im Bestfall unter Nutzung nachgewiesen nachhaltig nachwachsender Rohstoffe – bis 2030 zum Standard werden und die Flächeneffizienz beim Bauen durch höheres Bauen erhöht wird sowie in Summe weniger Flächen ausgewiesen werden. Das mindert die fortschreitende Versiegelung und setzt Personalkapazitäten im Baugewerbe für Sanierungsmaßnahmen frei.
Gehen Sie als Landkreis beim klimaneutralen Bauen auch selbst mit positivem Beispiel voran: Lassen Sie kreiseigene Liegenschaften zu „Effizienzhäusern“ sanieren, um ressourcenintensive Ersatzneubauten zu vermeiden; setzen Sie im Fall von Neubauten ab sofort auf höchste Energieeffizienz, 100% erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe, indem bei Neubauten Passivhausqualität oder die Auszeichnung „Platin“ der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen realisiert wird.
Hierfür empfehlen wir die Nutzung der unter Punkt 1) empfohlenen Strukturen, die mit entsprechenden Personalkapazitäten ausgestattet werden, um gezielte Beratung Architekt:innen und Bauwilligen anzubieten und die Kommunen bei der Aufstellung entsprechender Bebauungspläne und Satzungen unterstützen zu können.
Anbei senden wir Ihnen einen zweiteiligen Artikel über das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Landkreises Steinfurt, das auf hervorragende Weise aufzeigt, wie der Klimaschutz auch erfolgreich zur Wirtschaftsförderung und regionalen Entwicklung beitragen kann.
Als Gegenstück zu den vielen Katastrophen-Zukunfts-Schilderungen empfehlen wir zudem nachfolgende Lesung mit einem positiv-motivierenden Ausblick, wie unser Land nach GermanZero's Klimafahrplan im Jahr 2035 aussehen könnte, wenn wir unsere Verantwortung für den Klimawandel ernst nehmen und unverzüglich handeln: https://bit.ly/38TFmeL
Wir freuen uns, wenn Sie sich 11 Minuten Ihrer wertvollen Zeit zum Anschauen des Videos nehmen, um sich selbst inspirieren und Ihre Vorstellungen und Planungen für einen klimaneutralen Landkreis Erlangen-Höchstadt bereichern zu lassen.
Gerne stehen wir Ihnen für einen Austausch über unsere Vorschläge, für weitergehende Fragen oder für die Diskussion der konkreten Ausgestaltung zur Verfügung.
Mit klimafreundlichen Grüßen
die Vorsitzenden
Stefan Jessenberger, Energiewende ER(H) e.V.
Helmut König, Bund Naturschutz, KG Höchstadt-Herzogenaurach
Dr. Rainer Hartmann, Bund Naturschutz, KG Erlangen
Dr. Christoph Daniel, Landesbund für Vogelschutz
Peter Maier, Solarmobil Verein Erlangen e.V
25.05.2021 - BN Stellungnahme zum Vorentwurf des FNP Höchstadt
Flächennutzungs- und Landschaftsplan
Der BN hat eine umfangreiche, 16-seitige Stellungnahme zum Vorentwurf des Höchstadter Flächennutzungsplans abgegeben und lehnt diesen in dieser Fassung ab. „Dies ist aber nicht der Untergang Höchstadts, und nicht das Ende der Infrastruktur“ kommentiert Helmut König, Kreisvorsitzender des BN Artikeln in NN und FT, „sondern der Aufruf, dass es in diesem Umfang mit Flächenausweisungen im gesamten Stadtgebiet nicht mehr so weitergehen kann. Wer ein Herz für Kinder hat, schont auch die Natur.“
Schon 2010 hat der BN darauf hingewiesen, dass ein Flächenmanagement dringend nötig ist, passiert sei wenig. Selbst im Koalitionsvertrag von CSU und FW werde auf das Ziel hingewiesen, maximal 5 Hektar pro Tag auszuweisen. Aktuell werden im bayrischen Durchschnitt 11 Hektar pro Tag verbraucht. Als gäbe es kein Morgen, trotz Warnung aus Wissenschaft und Politik.
Der BN als überparteilicher Verband hat sich nun an einen Vorschlag eines ehemaligen Landes- und Bundestagsabgeordneten der CSU Josef Göppel gehalten, und auf Basis von 11 bzw. 5 Hektar pro Tag den „erlaubten“ Flächenbedarf für Höchstadt ermittelt. König hat errechnet, dass Höchstadt den bayrischen Durchschnitt dabei um mehr als 144 Prozent, und das gewünschte Ziel um 388 Prozent (!), also fast das Vierfache überschreitet. „Das sind die Fakten“, so König, „selbst in Orten wie Greiendorf oder Biengarten sollen Siedlungsflächen um 66 bzw. 43 Prozent vergrößert werden.“
Es geht aber laut BN auch anders. „Während Höchstadt für einen (bis 2037) prognostizierten Bevölkerungszuwachs von 677 Einwohnern satte 53 Hektar für neue Wohngebiete beansprucht, konnte in Adelsdorf für dieselbe Bevölkerungszahl im Wohngebiet Reuthsee entsprechender Wohnraum auf nur 12 ha bereitgestellt werden. Selbst wenn man eine derart kompakte, flächensparende Bauweise wie im Reuthseegebiet teils auch aus guten Gründen ablehnt, zeigen die Zahlen drastisch wieviel Raum für eine maßvollere Planung bestünde.
Diese maßlosen Flächenansprüche der Stadt Höchstadt sind aus BN Sicht tatsächlich eine Bedrohung der Zukunft der Kinder, aber offenbar nicht identisch mit den Vorstellungen des Höchstadter Bürgermeisters. Hinter diesen nackten Zahlen stehen dramatische Entwicklungen, die nicht nur die Lebensqualität und den Naturhaushalt, sondern die Artenvielfalt enorm gefährden. Der BN ist gegen eine ausufernde Wohnbebauung im Umfeld des Häckersteigs, da dieser ein kulturhistorisches wie ökologisches Kleinod mit besonders artenreicher Feldflur darstellt. Inakzeptabel sind auch die Planungen für ein 27 ha umfassendes Gewerbegebiet im Schwarzenbachtal am westlichen Stadtrand sowie einer Ausgleichsfläche direkt neben einem Feuchtbiotop am Rand des Vogelschutzgebiets Aischgrund, nahe der Kläranlage Höchstadt.
„Hochbedrohte Feldvogelarten wie Rebhühner, Feldlerchen und der in der Region inzwischen vom Aussterben bedrohte Kiebitz brüten dort regelmäßig noch in mehreren Paaren. Eingriffe in so hochwertige Bereiche seien daher heute unverantwortlich und praktisch nicht ausgleichbar.“, so der Biologe Manfred Ludwig und betont, dass „Artensterben nicht so einfach vom Himmel fällt und hier vor der eigenen Haustür stattfindet“.
Die Stadt sollte dringend über ihr Flächenbeschaffungskonzept, über Innenentwicklung und eine kreativ verdichtete Wohnstruktur nachdenken, sind sich die Naturschützer einig.
Für Rückfragen
Helmut König, 1. Kreisvorsitzender
19.04.2021 - Pressemitteilung zur Stellungnahme Südumfahrung Niederndorf-Neuses
Planfeststellungsverfahren Herzogenaurach
Der BUND Naturschutz (BN) hat im Rahmen seiner Aufgaben als Träger öffentlicher Belange eine umfangreiche Stellungnahme zur Südumfahrung erstellt. In der kurzen Frist sei eine beachtlich präzise Darstellung der Problempunkte gelungen, so Helmut König, Vorsitzender der BN Kreisgruppe. „Unsere Biologen haben uns nebenberuflich bestmöglich unterstützen, obwohl sie gerade im Frühjahr schwer ausgelastet sind, erklärt König.
Die Stellungnahme hat es aber in sich. Hier können nur die wesentlichen Problempunkte angesprochen werden, um den Rahmen nicht zu sprengen. Die wohl gravierendste Aussage laut König ist, dass „Verbotstatbestände nicht nur für den Mittelspecht, sondern auch für das Braunkehlchen und die seltene Bekassine“ vorliegen. Der Lebensraum dieser Tiere wird bedroht und kann nach Ansicht des BN auch nicht ausgeglichen werden. „Wie soll das denn funktionieren, wenn schon in den Vogelschutzgebieten im Landkreis seit Jahren der Erhalt dieser Arten nicht gelang“, bestätigt König die Aussagen der beteiligten Ornithologen. Verbotstatbestand nach EU-Recht bedeutet, dass die Straßenplanung eingestellt werden muss.
Es wird aber noch mehr bemängelt. Horst Eisenack, Ortsvorsitzender des BN-Herzogenaurach stellt in einer Detail-Arbeit fest, dass gravierende Wasserprobleme auf die Landwirtschaft und den Wald zukommen werden. „Belastetes Oberflächenwasser fließt in gesetzlich geschützte Biotope und zerstört dort langfristig die Vegetation oder wird schnellstmöglich in einen Vorfluter abgeleitet. So stellten die BN-Fachleute fest, dass auch ein Sumpfwald betroffen ist, der in der Planung überhaupt nicht auftaucht. Walddurchstiche fördern das Baumsterben durch Grundwasserabsenkungen oder Erwärmung zusätzlicher Waldränder.“
Ein zweites, sehr umfangreiches Fachgutachten bezieht sich auf den angeblichen volkswirtschaftlichen Nutzen und damit auf den CO2-Ausstoß. Das Ergebnis zeigt, dass die Südumfahrung um 2000 Tonnen CO2 jährlich mehr ausstoßen wird als die bisherige Streckennutzung. „Wollte man dies durch Bepflanzung kompensieren, wären 180 Hektar neuer Wald nötig. Das ist eine Fläche, begrenzt durch die Südumfahrungsstrecke und die Aurach.“ erklärt Eisenack, „also kein Vorzeigeprojekt in Sachen Klima für Herzogenaurach.“
Aber auch das mangelhafte Fledermaus-Monitoring und hohe Amphibienwanderungen werden thematisiert. „Wir beanstanden Naturzerstörung in Brasilien, haben aber Artenverlust vor der Haustür. Und Ausgleich ist für viele ein Alibi-Argument“, so der Kreisvorsitzende, „so stellt man nur sein Gewissen ruhig, der Natur nützt es aber wenig“.
Der BN fordert, dass Stadträte endlich mit den Bürgern aus Niederndorf und Neuses nach naturverträglichen Abhilfen suchen, der BN hat dazu viele Alternativen aufgeführt. „Auch die Firma Schaeffler, die bis 2030 CO2-neutral sein will, sollte nicht vergessen, dass auch der Transport zum CO2-Fußabdruck gehört, und entsprechend handeln“, so die Naturschützer.
Für Rückfragen
Helmut König, Kreisvorsitzender
29.03.2021 - Flächennutzungsplan Höchstadt weist massiv Flächen aus
Flächennutzungs- und Landschaftsplan Höchstadt
Die Stadt Höchstadt hat nach 30 Jahren endlich einen neuen Flächennutzungs- und Landschaftsplan zur Aufstellung gebracht. Es war auch allerhöchste Zeit. Seit die Stadt zum Mittelzentrum erhoben wurde, wächst der Flächenbedarf massiv. Nun wurde von der Kreisgruppe eine erste Grobabschätzung der Flächenausweisungen abgegeben, und diese fällt absolut negativ aus. Eine ausführliche Analyse muss in den nächsten Wochen noch erfolgen.
Bezieht man die Flächen oder die Einwohnerzahlen der Stadt Höchstadt mit ihren Ortschaften auf den, von der Regierung (Flächensparen) gewünschten Flächenverbrauch von 5ha/Tag als Basis, und rechnet man mit einer Gültigkeitsdauer der Planung von 15 Jahren, dann verbraucht Höchstadt mindesten das 4-fache des bayerischen Durchschnitts. Selbst bezogen auf den aktuellen Flächenverbrauch von 10ha/Tag (LfU) ist das immer noch mehr als das Doppelte des Bayerndurchschnitts.
Hierbei sind die freien oder zwischenzeitlich wieder unbenutzten Flächen noch gar nicht miteingerechnet. Aus Sicht des Naturschutzes stehen dabei zwei Standorte besonders im Fokus: Der Häckersteig und das Aischtal. Der Häckersteig, eine alte, absolut schützenswerte Terrassenlandschaft, die unbedingt erhalten werden muss. In der Aischaue ein geplantes Gewerbe- und Industriegebiet, eingelagert in eine vorhandene Teichlandschaft am Schwarzenbachgraben, obwohl im Osten Höchstadts bereits ein großes, teilweise lückiges Gewerbegebiet (Am Aischpark) existiert.
Nun sind die Planungsunterlagen zugänglich, wir werden diese im Detail prüfen. Wir hoffen, dass der Stadtrat noch zu der Überzeugung kommt, dass es so nicht weitergehen kann. Erste Kommentare aus dem Gremium lassen aber bisher wenig Umdenken erkennen.
Für Rückfragen
Helmut König, 1. Kreisvorsitzender
08.03.2021 - Bebauungsplan Aischtalring in Aisch
Adelsdorf/Aisch
Ende 2020 wurde auf Antrag der Grünen im Gemeinderat beschlossen, trotz eines beschleunigten Verfahrens nach §13b BauGB (Baugesetz) einen Umweltbericht zu erstellen. Dieser ist in der Begründung nur sehr rudimentär vorhanden, und sollte daher ergänzt werden. Trotz dieses Verfahrens sind die Umweltbelange zu ermitteln, inhaltlich zu prüfen und gerecht abzuwägen. Entsprechendes gilt auch für den Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung, also die Suche nach Nachverdichtungsmöglichkeiten.
Der BN lehnt Ausweisungen im Außenbereich nach dem vereinfachten Verfahren nach §13b BauGB ab. Dieser wurde Ende 2019 kurz vor Auslauf dieses Gesetzes im Gemeinderat beschlossen. Sollte diese Ausweisung vom Landratsamt akzeptiert werden, so müssen mindestens die Bauflächen wie geplant in verdichteter Bauweise erstellt werden.
Die artenschutzrechtliche Prüfung ist leider in mehreren Punkten mangelhaft, damit sind auch die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Arten unzureichend. Rebhuhn, oder mehr noch Kiebitze wurden überhaupt nicht beachtet, obwohl sie dort imer wieder vorkommen.
Für Neubauten sollten Solaranlagen zwingend vorgeschrieben werden (Adelsdorfer Klimaoffensive).
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
23.12.2020 - Badweiher Weisendorf – Gemeinde ignoriert Einwände der UNB
Man muss es sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Gemeinderat verabschiedet eine Planung für den Badweiher. Die Umsetzung weicht dann davon ab, indem das Ufer vollständig versteint wird und alle ökologischen Komponenten einfach unter den Tisch fallen. Der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein steht dazu und findet das gut. Die Einwände der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) werden geflissentlich ignoriert und der Weiher aktuell geflutet.
Nach Artikel 141 der Bayerischen Verfassung ist es eine der vorrangigen Aufgaben der Gemeinden besondere Fürsorge für die Natur walten zu lassen. Der mit Mitteln der Städtebauförderung für horrendes Steuergeld umgestaltete Badweiher zeigt jedoch genau das gegenteilige Ergebnis.
Auf die Einwände der UNB angesprochen, spricht Karl-Heinz Hertlein davon, dass die Witterung weiteren Maschineneinsatz nicht zulasse, da der Boden in dieser regenreichen Zeit zu weich sei. Tatsachlich wurden in Weisendorf im November gerade mal 9 Liter Niederschlag gemessen und der Boden ist auch Mitte Dezember noch völlig trocken. Die geforderten Nachbesserungen. müssen nach Aussage des zweiten Bürgermeisters im Spätsommer „nachverhandelt" werden.
Was sagt der Gemeinderat zur Missachtung seiner Planung? Ist die Abweichung von der Planung eigentlich mit den Richtlinien der Städtebauförderung verträglich? Und was wird das Ergebnis sein? Die Untere Naturschutzbehörde wird am Nasenring durch die Manege geführt und die Natur bleibt wie gewohnt auf der Strecke. Es ist eine Schande!
Unterstützung der Artenvielfalt oder Fürsorge für die Natur, Forderungen der Fridays for Future … Fehlanzeige. Das alles sind Themen, die in der Verwaltung der Gemeinde Weisendorf noch nicht angekommen sind. Es wird Zeit, dass sich das ändert.
Für Rückfragen:
Christian Wosegien, Ortsgruppe Seebachgrund, 1. Vorsitzender
05.11.2020 - Sanierung Badweiher Weisendorf
Die Sanierung des Badweihers schreitet voran. Leider ist vom Vorschlag des BUND Naturschutz, diese gemeindeeigene Fläche im Sinne einer Förderung der Artenvielfalt zu gestalten, nichts übrig geblieben. Vielmehr sind inzwischen die Weiherränder und das Inselufer vollständig mit Steinen zugepflastert. Selbst die frühere Verlandungszone wurde davon nicht verschont. Haben die ursprünglichen Pläne nicht anders ausgeschaut? War da auf der Nordseite nicht mal von organischem Material zur Uferbefestigung die Rede? Was sagt der Gemeinderat dazu? Am Ende ergeben sich in Summe etliche hundert Meter ökologisch totes Ufer – oder anders formuliert: Hier wurde mit hunderttausenden Euros aus Steuermitteln ein weiterer Weiher für die traditionelle Teichwirtschaft umgebaut, der sich nur durch die Insel von den anderen negativen Beispielen in der Landschaft abhebt. Die logische Konsequenz kann nur sein, den Badweiher in „Goldene Karpfenwanne“ umzubenennen.
Der südliche Weiherdamm wurde zum Boulevard ausgebaut. Wieder ist ein störungsfreier Lebensraum verloren gegangen. Wieder wurden, wie schon beim Schlossgarten und der Seebachmündung in den Mühlweiher, naturnahe Strukturen im Siedlungsraum leichtfertig zerstört.
Heißt es nicht im Artikel 141 der bayerischen Verfassung, es ist eine vorrangige Aufgabe der Gemeinde sorgsam mit der Natur umzugehen? Was wird in Weisendorf darunter verstanden?
Vielleicht kann man diesem traurigen Ergebnis doch noch etwas Positives abgewinnen. So hoffen wir, dass dieses abschreckende Beispiel die Gemeinde dazu bewegt, zukünftig ihre Flächen nur noch unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes zu bewirtschaften und mit entsprechenden Auflagen zu verpachten. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist das eine riesengroße Erfolgsgeschichte. Was spricht eigentlich dagegen, diesem Beispiel zu folgen?
Der erste Schritt wäre, bei der „Goldenen Karpfenwanne“ vor der ersten Flutung mit der Renaturierung zu beginnen.
Für Rückfragen:
Christian Wosegien, Ortsgruppe Seebachgrund, 1. Vorsitzender
24.06.2020 - 365 EURO Ticket contra Südumfahrung Herzogenaurach
Wohlstand, Lebensqualität und Mobilität ohne neue Straßen ist das Leitziel des BUND Naturschutz (BN). Auch haben wir keinen Zweifel gelassen, dass das Verkehrssystem um Herzogenaurach nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden muss. Nur durch konsequentes Verlagern des Verkehrs auf Öffentliche Verkehrsmittel reduzieren wir den Verkehrsdruck auf unsere Städte, Dörfer und deren Einwohner. Der Verkehr im Umfeld von Neuses bis zu den Schaeffler-Werken wird selbst durch die Südumfahrung langfristig nicht verringert. Die Reduzierung des Autoverkehrs, damit einhergehend von Lärm, Unfällen, CO2 und anderen Abgasen kann nur durch weniger individuellen Verkehr gelingen.
Wir begrüßen ausdrücklich die Verbesserungen im öffentlichen Verkehr der letzten Monate. Die aktuelle Diskussion um ein 365 Euro-Ticket innerhalb des Städtedreiecks inklusive unseres Landkreises, auch mit Unterstützung des neuen Nürnberger Bürgermeisters und unseres Landrats lässt auf einen Wandel hoffen. Da kann man nur sagen: „Endlich nimmt man Verbesserungen im Öffentlichen Nahverkehr auch ernst“.
Wir appellieren an die zunehmende Einsicht der Herzogenauracher SPD, dass konkurrierende Systeme nicht zum Erfolg führen. Dies bestätigen auch viele Verkehrsplaner. Wir hoffen, dass die Stadträte den Umstieg auf die Öffentlichen Verkehrsmittel favorisieren und alles unternehmen, um dies auch durch entsprechende Planungen zu unterstützen. Die Südumfahrung ist kontraproduktiv für StUB, für Busse, für eine Aurachtalbahn, und sollte endlich ad acta gelegt werden. Auch Schaeffler sollte dabei seine Verantwortung für die Zukunft des Herzogenauracher Verkehrsaufkommens übernehmen.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
18.12.2019 - Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz
31.08.2019 - Raumordnungsverfahren Stadt-Umland-Bahn
26.07.2019 - Gewerbegebiet Süd im Sand II in Röttenbach
12.05.2019 - Stellungnahme Wohngebiet Neuhaus "Steigerwaldblick"
13.03.2019 - Kritik an weiterem Gewerbegebiet in Röttenbach
11.02.2019 - Start der „Hilfe für Kiebitze“ für 2019
18.12.2019 - Gesellschaftsvertrag für eine neue Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz
Nach wie vor kursieren bei Bauernprotesten Vorwürfe, Umweltauflagen schadeten der Landwirtschaft und wären derzeit der Grund für die Aufgabe von Bauernhöfen. Der BUND Naturschutz (BN) und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft (AbL) warnen vor solchen haltlosen Vorwürfen.
Agitiert wird vor allem das sogenannte Agrarpaket der Bundesregierung, das minimale Änderungen an den Direktzahlungen an die Landwirte beinhaltet, sowie Düngungseinschränkungen in Gebieten vorschreibt, bei denen hohe Nitratwerte im Grundwasser nachgewiesen wurden. Außerdem richtet sich der Protest gegen die geplanten Einschränkungen von Unkrautvernichtungsmitteln und teilweise auch Insektiziden in Schutzgebieten, in denen auch bisher kaum Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden.
Proteste fehlgeleitet
"Die Proteste der Bäuerinnen und Bauern sind grundsätzlich berechtigt. Auch der BUND Naturschutz demonstriert gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern, Entwicklungs- und Tierschutzorganisationen während der Grünen Woche in Berlin für eine Neuausrichtung der Agrar- und Förderpolitik.", so Richard Mergner, BN Vorsitzender. "Wir setzen uns seit vielen Jahren für neue Rahmenbedingungen ein, die eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft statt einer immer intensiveren Industrielandwirtschaft fördert."
"Die Folgen dieser ständigen Intensivierung für Billigproduktion und Weltmarkt können nicht über technische Verfahren zur Gülleausbringung, größere Güllelager und immer neue Auflagen gelöst werden, es müssen die Ursachen angegangen werden", so Josef Schmid, Vorsitzender der AbL Bayern. Was die bäuerliche Landwirtschaft braucht, ist Abkehr von der Intensivierungsfalle, ein Umbau des Fördersystems, damit bäuerliche Arbeit, artgerechte Tierhaltung und Umweltleistungen entlohnt werden. Ungeeignet sind pauschale Flächenprämien, denn diese werden zum großen Teil an die Verpächter durchgereicht, und bieten Immobilienaufkäufern- nicht nur in Ostdeutschland- hohe jährliche Renditen.
"Es macht wenig Sinn, sich gegen den Vollzug europäischer Umweltgesetze, wie der Nitrat- und Wasserrahmenrichtlinie zu wenden", so Josef Schmid, und weiter: " Bäuerinnen und Bauern brauchen durch eine Weiterentwicklung der Gemeinsamen Marktordnung eine besseren Marktstellung gegenüber der Verarbeitungsindustrie, wie Molkereien, Schlachtunternehmen, aber auch Mühlen und Lagerhäusern damit sie durch faire, kostendeckende Preise wirtschaftlich in die Lage versetzt werden, höheren gesellschaftlichen Anforderungen betreffs Artenvielfalt, Tiergerechtigkeit, Klima- oder Umweltschutz gerecht zu werden. Alle Marktbeteiligten müssen bereit sein, Überproduktion zu vermeiden und die Mengen an den Bedarf einer ernährungsbewussteren Verbraucherschaft anzupassen.
"Systembashing" nicht "Bauernbashing"
"Das vielbeklagte "Bauernbashing" ist in Wirklichkeit eine Kritik an den falschen agrarpolitischen Weichenstellungen, denn zu hohe gesundheitsschädliche Nitratwerte in Teilen unseres Grund- und Trinkwassers und das Insektensterben sind nicht wegzudiskutieren, und wesentlich durch die Intensivierung der Landwirtschaft verursacht. Nicht Bäuerin oder Bauer stehen im Fokus der gesellschaftlichen Kritik, sondern die verfehlte agrarpolitische Weichenstellung", so Stephan Kreppold, Sprecher des BUND Naturschutz Arbeitskreises Landwirtschaft. "Landwirte und Umweltverbände sollten zusammenarbeiten um die notwendige gesellschaftliche Unterstützung für eine neue Agrarpolitik zu erreichen."
BN und AbL sind sich einig, dass Hofaufgaben und fehlende Hofnachfolger nicht durch das Volksbegehren "Rettet die Bienen" oder das Agrarpaket der Bundesregierung verursacht sind.
Tatsache ist aber, dass der Strukturwandel eine gewollte Folge der seit Jahrzehnten herrschenden Handels- und Niedrigpreis-Agrarpolitik ist, die unterstützt durch Agrarwissenschaft, Beratung durch Pflanzenschutz- und Düngemittelvertreter, gerade auch in den landwirtschaftlichen Fachmedien, sowie in der Landwirtschaftsausbildung und -beratung, viele Betriebe zum Aufgeben gezwungen oder in die Existenzkrise getrieben hat. Weitere Folge dieser Weichenstellung, die die Absätze der Agrochemiesparte genährt hat, sind die nicht mehr zu leugnenden massiven Belastungen im Naturhaushalt, für die das intensive Landwirtschaftssystem eine der Hauptverursacher ist.
Richard Mergner, Landesvorsitzender
Für Rückfragen
Helmut König, Kreisvorsitzender
31.08.2019 - Raumordnungsverfahren Stadt-Umland-Bahn
Die beiden BUND Naturschutz (BN) Kreisgruppen (KG) Höchstadt-Herzogenaurach und Erlangen haben eine Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren (ROV) der Stadt-Umland-Bahn (StUB) abgegeben. Diese wurden dann vom BN-Landesverband zu einem Dokument zusammengeführt. Im Folgenden wird der Standpunkt der KG Höchstadt-Herzogenaurach für deren Bereich dargestellt.
Der BN begrüßt die Planungen zur Stadt-Umland-Bahn, stellt sie doch ein wichtiges Verkehrsmittel der Zukunft unter Aspekten des Klimaschutzes, der Luftreinhaltung und des Flächensparens dar. Die Stadt-Umland-Bahn ist ein modernes, attraktives und kundenfreundliches Verkehrsmittel. Es ist eine Investition in die Zukunft, damit die prosperierende Metropolregion Nürnberg nicht noch mehr im Individual-KFZ-Verkehr erstickt.
Der BN sieht in einem ausbaufähigen, schienengebundenen Verkehrssystem, das auch über die Grenzen Herzogenaurachs erweiterbar ist, das zukunftsfähigere Verkehrssystem. Damit könnte mittelfristig auch der von etlichen Bürgermeistern der östlich von Erlangen gelegenen Gemeinden ursprünglich geplante T-Zweig realisiert werden.
Insgesamt wurden fünf Varianten betrachtet, davon kamen drei in die nähere Auswahl für das ROV. Für Herzogenaurach bevorzugt der BN nicht die empfohlene Variante über die Rathgeberstraße sondern jene über die Flughafenstraße. „Aus Naturschutzgründen bevorzugen wir diese Variante. Es wäre auch im Sinne des steigenden Interesses breiter Bevölkerungskreise, Natur und Artenvielfalt mehr zu beachten,“ betont der Kreisvorsitzende Helmut König.
Die Route über die Rathgeberstraße muss vor ihrem Endziel bei Schaeffler eine längere Strecke durch die Aurachtalaue zurücklegen. Dabei werden potenzielle Habitate von Fledermäusen, des Bibers, der Zauneidechse, Eisvögel sowie hecken- und höhlenbrütender Vogelarten gestört. Bäume müssen weichen. Auch der Weißstorch ist betroffen. „Dies würde erhebliche Eingriffe in sensible Biotope nach §30 Bundesnaturschutzgesetz im Aurachtal bedeuten. Wir sind der Meinung, dass die Natur, und hier vor allem der Artenschutz im ROV zu gering bewertet werden.“, so König. Außerdem haben die Naturschützer festgestellt, dass die Biotopanzahl gegenüber 1995 sogar zugenommen hat, während die Planer der Meinung sind, dass der naturschutzfachliche Wert bereits verkehrlich vorbelastet ist.
Besonders mangelhaft findet der BN, dass eine grundlegende Aufgabe eines ROV, die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Vorhaben zu prüfen, komplett ignoriert wird. Im vorliegenden Fall zählen dazu konkurrierende Verkehrssysteme, da diese Akzeptanz, Fahrgastzahlen und anderes stark beeinflussen. Damit wird auf die, für den BN naturzerstörende geplante Südumfahrung hingewiesen, die ebenfalls an gleicher Stelle in das Aurachtal einmünden soll. Für König ist diese Straße „ein absolutes Verhinderungswerkzeug für einen erfolgreichen Betrieb der StUB im Bereich Herzogenaurach.“
Nicht optimal seien der weit auseinander liegende Busbahnhof und die Endstation der StUB. Als eine dringliche Aufgabe für die Stadt zur weiteren Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs sollte ein Park+Ride Platz in unmittelbarer Nähe zur Aurachtal Raststätte realisiert werden, auch wenn die Stadt dort für Überbrückungswerke zusätzlich investieren müsste.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
Volker Grünenwald, BN Vertreter im Dialogforum
26.07.2019 - Gewerbegebiet Süd im Sand II in Röttenbach
Der Bund Naturschutz (BN) lehnt weiterhin das geplante Baugebiet ab und sieht sich in seiner ablehnenden Haltung einig mit maßgeblichen Behörden. In der Stellungnahme am 26.07.2019 wurde dies der Gemeinde im Detail mitgeteilt.
Die erneute Abwägung der Stellungnahmen zur Erweiterung des Röttenbacher Gewerbegebiets, die einstimmig im Gemeinderat gefasst wurde, ist für den BN symptomatisch. Nicht die Zerstörung von Feuchtflächen ist Thema, sondern dass kein abbauwürdiges Sandvorkommen mehr vorhanden ist. Die Aussage, der hohe Flächenverbrauch sei eine subjektive Darstellung, wie vom Planer geäußert wurde, widerspricht den Vorgaben der Staatsregierung, sei also objektiv richtig.
Der Bund Naturschutz sieht sich in seiner ablehnenden Haltung einig mit maßgeblichen Behörden.
Bereits der Planungsverband der Region Nürnberg weist darauf hin, dass in diesem Gebiet der "Sicherung und dem Erhalt besonders schutzwürdiger Landschaftsbestandteile besonderes Gewicht beigemessen" werden soll. Die an das Bauvorhaben angrenzenden geschützten Feuchtwiesen würden beeinträchtigt. Auch das Landratsamt hatte bereits negative Auswirkungen auf die angrenzenden Biotopflächen befürchtet. Die geplante Maßnahme habe zudem erhebliche Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung, so der Umweltbericht. Das berühre vor allem die lokalen Röttenbacher Wasserschutzgebiete und den Wasserzweckverband der Seebachgruppe.
Auch das Wasserwirtschaftsamt wehrt sich: "Permanente Grundwasserabsenkungen können nicht befürwortet werden".
Das Röttenbacher Wahrzeichen - die Weißstörche - wären ebenfalls betroffen. Sie betrachten diese Feuchtwiesen als ihre "Hofwiese". Vor allem bei ungünstiger Witterung seien solche Nahrungsflächen wegen der kürzeren Transportwege wichtig, weil bei hohem Fütterungsbedarf in der Nestlingszeit der Anflug der Altvögel mit nassem Gefieder sehr kräftezehrend sei.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den unangemessen hohen Flächenverbrauch in Röttenbach.
Wenn man das von der Bayrischen Staatsregierung ausgegebene Ziel von maximal 5 ha pro Tag als Maßstab nimmt, dann stünde der Gemeinde Röttenbach innerhalb einer Wahlperiode von 6 Jahren insgesamt 1,2 ha zu. Tatsächlich aber befinden sich in Röttenbach insgesamt Flächen von 12,4 ha in Planung. Damit wird das für Röttenbach zugestandene Kontingent um mehr als Faktor 10 überschritten. Neun andere vergleichbare Gemeinden müssten daher zum Ausgleich für die Dauer von 6 Jahren auf jeglichen Flächenverbrauch verzichten.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
Birgit Schwering, 2. Vorsitzende Ortsgruppe Röttenbach-Hemhofen
Alfons Zimmermann, Schriftführer Ortsgruppe Röttenbach-Hemhofen
12.05.2019 - Stellungnahme Wohngebiet Neuhaus "Steigerwaldblick"
Die Gemeinde Adelsdorf weist ein neues Wohngebiet in Neuhaus aus. Für Ortsansässige, wie es in den Unterlagen heißt. Der BUND Naturschutz (BN) glaubt dies aber nicht und hat dies in einer ausführlichen Stellungnahme begründet. In einer Pressemitteilung erläutert die Ortsgruppe ihren Standpunkt.
Seit Jahren wird um ein Flächensparen gerungen. Im Koalitionsvertrag wurde das Ziel vereinbart, den Flächenverbrauch massiv zu verringern. Der BN drängt darauf, den schönen Worten auch Taten folgen zu lassen. „Im Baugesetz wird die Wiedernutzbarmachung von Flächen ausdrücklich als Vorrangig aufgeführt“, erläutert der Orts- und Kreisvorsitzende Helmut König. „Es ist nicht verständlich, warum die bereits in der Planung befindliche Wandlung des ehemaligen Werksgeländes der Firma Dennerlein in ein Wohngebiet wieder fallen gelassen wurde.“ Das ehemalige Betriebsgelände sei sogar größer als das nun wieder neu auszuweisende Baugebiet am Ortsrand, das fast drei Hektar Ackerland vernichtet.
Obendrein soll das Gebiet nicht durch Bauwillige aus Adelsdorf/Neuhaus beplant werden können, sondern durch ein Planungsbüro, das offensichtlich auch die Vermarktung übernimmt. Hier hat der BN die Bedenken, dass wie im Baugebiet Reuthsee (SeeSide) hauptsächlich durch „Auswertige“ das Wohngebiet bezogen wird. Neben höheren Kosten für Bauwillige werden auch „Einheimische“ wenig Berücksichtigung finden, da die Baufirma das Interesse hat, das Gebiet zügig zu bebauen.
„Auch sonstige Flächenrecyclingpotentiale oder Nachverdichtungsmöglichkeiten werden nicht angedacht“, erläutert König. Er stellt auch noch eine hoch interessante Rechnung auf, die den Flächenverbrauch unterstreichen. Nimmt man die Aussagen der Staatsregierung ernst, so darf Adelsdorf erst wieder in 2,1 Jahren weiteres Bauland ausweisen. „Rechnet man das Reuthseegebiet nachträglich noch mit ein und beachtet nicht, dass ein Großteil des Gebietes bereits Gewerbegebiet war, so dürfte erst in 16,3 Jahren in Adelsdorf weiteres Bauland ausgewiesen werden.“
Flächenverbrauch
Als eines der obersten Gebote der Bauleitplanung gilt der sparsame Umgang mit Grund und Boden. Die Regierung hat die Zeichen der Zeit schon lange erkannt. Seit Jahren wird um ein Flächensparen gerungen. Im Koalitionsvertrag wurde das Ziel vereinbart, den Flächenverbrauch massiv zu verringern.
Im Gesetz wird die Wiedernutzbarmachung von Flächen ausdrücklich als vorrangig aufgeführt. Dagegen wird im vorliegenden Verfahren verstoßen. In Neuhaus wurde mit der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Neuhaus Nordwest“ aufgezeigt, dass eine entsprechende Fläche für eine Wohnbebauung vorhanden wäre, bisher jedoch nicht genutzt wird. Die dort benannte Fläche ist größer als die nun wieder im Außenbereich liegende. „Die Änderung wurde aber vom Gemeinderat nicht weiter verfolgt – welche Sinneswandlung?“, so König.
Dringender Bedarf nicht begründet
Für die Ausweisung neuer Siedlungsflächen muss aus Gründen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ein deutlicher Bedarf nachgewiesen werden. Der Bedarfsnachweis wird nicht geführt.
Die Gemeinde verweist zwar auf einen Bedarf für die ortsansässige Bevölkerung, vergibt aber die Planung an eine Privatfirma. Inklusive deren Vertriebspartner wird damit das Wohngebiet großräumig angepriesen. Ortsansässige Interessenten müssen mit höheren Baupreisen rechnen, vom schnellen Ausverkauf der Fläche ganz zu schweigen. Der Planer hat das Interesse, das Baugebiet möglichst schnell zu füllen und nicht langfristig für Ortsansässige Bauland vorzuhalten. Das Baugebiet SeeSide sollte ein Beispiel sein: In den Planungsunterlagen findet man die Aussage, jährlich 57 Wohnungen zu realisieren. Ein Zeitraum von 10 Jahren war damit vorgegeben. Tatsächlich sucht man bereits 3 Jahre später weitere Wohnflächen!
Flächenrecyclingpotentiale oder Nachverdichtungsmöglichkeiten werden nicht angedacht.
Nachhaltige Entwicklung
Der Flächenverbrauch in Bayern beträgt nach statistischen Erhebungen derzeit etwa 11,7 ha pro Tag und stimmt somit vor dem Hintergrund des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie u.a. im bereits erwähnten Koalitionsvertrag festgehalten wurde, bedenklich.
„Daher sollte sich die Gemeinde Adelsdorf an die Vorgabe halten, Entwicklungsmöglichkeiten innerorts auszuweisen.“ so die Naturschützer.
Rückfragen an:
Helmut König, Kreisvorsitzender
13.03.2019 - Kritik an weiterem Gewerbegebiet in Röttenbach
Landschaft erhalten? Ja bitte - Flächenfraß? Nein danke!
Mit einer Fotoaktion gegen die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes "Süd im Sand II" in Röttenbach machten VertreterInnen des Bund Naturschutz (BN) am 13. März 2019 auf den anhaltenden Flächenverbrauch und die Landschaftsverschandelung in Bayern aufmerksam. Die Akteure bedeckten eine landwirtschaftliche Nutzfläche in drei Minuten mit 250 Quadratmeter schwarzer Folie.
"Wir wollen zeigen, wie viel Fläche in Bayern Tag und Nacht unwiederbringlich verloren geht. Derzeit sind es 81 Quadratmeter pro Minute", so Helmut König, 1. Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach. "Es gilt, verbliebene Naturlebensräume nicht weiter zu schmälern, wir stehen aber auch hier, um Bayerns Schönheit, unsere fränkische Kulturlandschaft und unsere Naherholungsgebiete zu bewahren."
Andrea Wahl, 1. Vorsitzende der Ortsgruppe Röttenbach-Hemhofen des BN: "Die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes würde weitere 2,5 Hektar wertvolle Flächen zerstören. So darf es nicht weiter gehen, denn die Ressource Boden steht uns nun mal nicht unendlich zur Verfügung."
"Wir appellieren an die Gemeinde Röttenbach, die Zerstörung wertvoller Lebensräume von gefährdeten und geschützten Arten wie Zauneidechse und Laubfrosch nicht noch zu forcieren", so Tom Konopka, mittelfränkischer BN-Regionalreferent. "Das Volksbegehren 'Rettet die Bienen' hat gerade erst gezeigt, dass das Thema ernster genommen werden muss."
Die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes soll nach Angaben der Gemeinde Röttenbach für die Ansiedelung von neuen Gewerbe- und Industriebetrieben sowie der baulichen Erweiterung von zwei Betrieben und der Umsiedelung eines Gewerbegebietes genutzt werden. Dabei könnten nach den Angaben in der Begründung zum Bebauungsplan "Süd im Sand II" Gewerbegebäude mit einer maximalen Gebäudehöhe von bis zu 11 m und einer Gebäudelänge von 50 bis zu 75 Metern direkt am Ortseingang von Röttenbach gebaut werden.
Der Bedarf für ein weiteres Gewerbe- und Industriegebiet wird allerdings nicht schlüssig nachgewiesen, eine Aufstellung vorhandener, bereits erschlossener Gewerbe- und Industrieflächen wird nicht vorgelegt. "Nimmt man das bestehende Gewerbe- und Industriegebiet als Grundlage, würde dieses um 66 Prozent erweitert, bezieht man die gesamten Mischflächen im Dorf mit ein, betrüge die Erweiterung immer noch stolze 10 Prozent." erklärt König.
Generell steht das Vorhaben "Erweiterung des Gewerbegebietes" im Widerspruch zum Baugesetzbuch, das vorrangig Innenentwicklung vorschreibt, und zu den Zielen der Staatsregierung, die den Richtwert 'maximal 5 Hektar pro Tag' in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Es widerspräche auch den Zielen des Bündnisses zum Flächensparen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit und vom Ministerium des Inneren propagiert werden. Mit dem "Bündnis zum Flächensparen", dem mittlerweile über 40 Partner, z. B. Staatsregierung, kommunale Spitzenverbände, Kommunen, Kirchen und Umweltverbände, angehören, soll der Flächenverbrauch reduziert werden. Dazu gehören Projekte wie das "Kommunale Flächenressourcen-Management", das gerade die Innenentwicklung vorantreiben soll.
Erst am 15.11.18 gab das Landesamt für Statistik bekannt, dass der Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke in 2017 in Bayern um 20 % auf 11,7 Hektar täglich gestiegen ist. Das sind 117.000 Quadratmeter pro Tag oder 81 Quadratmeter pro Minute. Immense Naturflächen gehen dadurch verloren - und damit die Naturräume, die von allen Lebewesen dringend als Lebensraum benötigt werden.
Aus Sicht des BN wird die Planung vor allem abgelehnt, weil besonders schützenswerte Landschaftsteile zerstört und beeinträchtigt würden. Hierzu zählen insbesondere erfassten extensiv genutzten Wiesen- und Weidenflächen und die angrenzenden Weiher. Durch die geplante Versiegelung bzw. Überbauung käme es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter.
Selbst aus dem Umweltbericht der Gemeinde Röttenbach kann man entnehmen, dass im Plangebiet die Boden- und Wasserfunktionen unwiederbringlich verloren gingen und stark beeinträchtigt würden. Die Bebauung des Plangebietes würde zu einer Änderung des Oberflächenwasserabflusses führen, wodurch es zu einer Beeinträchtigung der tiefer gelegenen Feuchtfläche südlich des Plangebietes kommen könnte.
Der Umweltbericht weist etliche schützenswerte Arten auf, die dort ihren Lebensraum verlieren, wie Zauneidechse, Laubfrosch, Neuntöter, Goldammer und Dorngrasmücke. "Mit der Zerstörung der Flächen widerspricht man von kommunaler Seite dem gerade verstärkten Wunsch nach mehr Artenschutz, der durch das Volksbegehren von breiter Seite angemahnt wurde", betont König.
Der für diese Tiere notwendige natürliche Lebensraum ginge für immer verloren. "Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen stehen im keinem Verhältnis zu der Größe des geplanten Gewerbegebietes und kosten der Gemeinde viel Geld", ergänzt Andrea Wahl. "Eine erfolgreiche Umsiedelung der Tiere kann keinesfalls garantiert werden und ist immer Wunschdenken der Planer." Auch fehlen immer noch notwendige Ausgleichsflächen. Zum Zeitpunkt der öffentlichen Beteiligung hatte die Gemeinde noch ein Defizit von fast 0,6 Hektar.
"Vor allem junge Familien mit kleinen Kindern ziehen bewusst aufs Land nach Röttenbach, um die einmalige und unersetzbare Natur direkt vor ihrer Haustür erleben zu können. Daher möchten wir, dass auch für unsere nachfolgenden Generationen diese erhalten bleibt und unsere Ortseinfahrt nicht durch überdimensionierte Gewerbebauten zusätzlich noch verschandelt wird", wünscht sich Andrea Wahl.
Tom Konopka, Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken
Helmut König, Kreisvorsitzender
Andrea Wahl, Ortsvorsitzende Röttenbach-Hemhofen
11.02.2019 - Start der „Hilfe für Kiebitze“ für 2019
Am 11.02.2019 fand die diesjährige Auftaktveranstaltung für die Aktion „Hilfe für Kiebitze“ im Landhotel Drei Kronen in Adelsdorf statt. Der Bund Naturschutz (BN) Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach und die Unteren Naturschutzbehörde (UNB) hatten das Projekt zum Schutz der immer seltener werdenden Kiebitze gemeinsam ins Leben gerufenen. Vierundzwanzig Personen werden 2019 wieder aktiv daran teilnehmen.
Helmut König, der Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz für Höchstadt-Herzogenaurach bedankte sich rückblickend bei den „Standbeobachtern“. Das seien Personen die zwei bis dreimal die Woche morgens in acht ausgewählten Arealen des Landkreises nach brutwilligen Kiebitzen Ausschau hielten und den ungefähren Standort dokumentieren. Die UNB bittet daraufhin die Landwirte – gegen Entschädigung – um Rücksichtnahme auf die Brutgebiete in ihren Äckern und Wiesen, Ornithologen markieren die Nester.2018 waren 19 Beobachter insgesamt 263 Mal morgens unterwegs und sichteten dabei mindestens 1612 Kiebitze. „Das sind zwar nur die Sichtkontakte der Beobachter, nicht die tatsächliche Zahl der für den Aischgrund ehemals typischen Vögel“, erläutert König. „Letztendlich wurden lediglich 21 Brutpaare registriert“. Für den Ornithologen Thomas Stahl sind das dann abzüglich der Verluste bei der Aufzucht der Jungen höchstens 40 überlebende Jungvögel. „Das ist zu wenig für den Erhalt der Kiebitze im Landkreis“, so der Fachmann.
Aber auch das trockene Jahr 2018 hat dabei einen gehörigen Einfluss. „Alle Vögel haben da Probleme. So sind auch Störche auf der Suche nach Fressbarem. Finden sie zuwenige Amphibien als Nahrung, werden auch junge Kiebitze gefressen.“ schildert Stahl.
Andreas Sehm von der UNB ist für die Verträge mit den Landwirten zuständig. Er verweist auf acht abgeschlossene Vereinbarungen mit insgesamt 14 Kiebitz-Nestern. „Landwirte sind für die Hilfe absolut aufgeschlossen. Für vier Nester konnten keine Abschlüsse geschlossen werden, obwohl der Landwirt die Vögel schonte. Nur in einem Fall wurde ein festgestelltes Gelege durch Überfahren zerstört. Eine absolute Ausnahme.“ erklärt der Behördenvertreter.
„Wesentlich für den Bestanderhalt ist eine gewisse Koloniengröße. Diese wurde 2018 nur im Raum Mühlhausen, bei Hesselberg und an den Brandweihern bei Neuhaus erreicht“ erläutert der Ornithologe Stahl. Genau dort plant die Gemeinde Adelsdorf im Vogelschutzgebiet eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage. Nicht gerade erstrebenswert für die Naturschützer.
König hat aber Hoffnung, dass sich aufgrund des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ auch weitere Verbesserungen eröffnen. „Das vom Bauernverband so bemängelte Verbot des Walzens von Dauergrünflächen betrifft in erster Linie die Bodenbrüter, so auch die Feldlerche.“ erläutert König, „man kann doch genau diese Flächen staatlich fördern, wo Wiesenbrüter ihre Nester bauen. Das ist nicht ein Problem der Landwirte, sondern eines der Politik.“
„Der Naturschutz ist keinesfalls Gegner der Landwirtschaft, wie von einigen Vertretern des Bauernverbandes zuletzt immer behauptet wurde. Aber industrielle, das heißt großflächige Bewirtschaftung mit damit einhergehendem Pestizideinsatz und ausgeräumten Landschaften, muss zurückgedrängt werden, sind sich die Teilnehmer an der Aktion einig.
Für Rückfragen:
Helmut König, Kreisvorsitzender
17.12.2018 - Stellungnahme zur Photovoltaik-Freiflächenanlage Neuhaus Süd
17.06.2018 - Gespräche zur Energiewende mit Mitgliedern des Bundestages
21.05.2018 - Biotop Kerschensteiner Straße, Höchstadt
19.05.2018 - Schreiben an BGM Brehm, Biotop an der Kerschensteiner Straße, Höchstadt
18.04.2018 - BN Mitgliederversammlung in Niederndorf
14.03.2018 - Hilfe für Kiebitze - Start eines mehrjährigen Naturschutzprojektes
21.01.2018 - Ernsthafte Bewertung der Aurachtalbahn
01.01.2018 - Widerspruch gegen Eisenbahn-Bundesamt
17.12.2018 - Stellungnahme zur Photovoltaik-Freiflächenanlage Neuhaus Süd
Der BN hat zur geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage Neuhaus Süd, die zum überwiegenden Teil im Vogelschutzgebiet an den Brandweihern bei Neuhaus liegt, eine ablehnende Stellungnahme abgegeben. Die relativ ausführliche Begründung wird nachfolgend etwas verkürzt wiedergegeben.
Allgemeines zum Vogelschutzgebiet und zu regenerativen Energien
Die EU-Vogelschutzrichtlinie schützt ausgewählte wildlebende Vogelarten, indem besondere Schutzgebiete ausgewiesen wurden. Die Gebietsauswahl erfolgte nach rein fachlichen Kriterien aufgrund europaweit gefährdeter Arten. Der BN befürwortet den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien und damit auch von Photovoltaikanlagen, die einen wichtigen Teil zur Umsetzung der Energiewende beitragen.
Mittlerweile ist es unstrittig, dass die Gefährdung und der massive Verlust von Arten hauptsächlich die Folge menschlichen Handelns ist, das durch die Veränderung der natürlichen Lebensräume, deren Störung, Zergliederung und Behandlung mit zum Teil toxischen Stoffen verursacht wird. Dieser Entwicklung Einhalt zu bieten und das europäische Naturerbe für künftige Generationen zu bewahren bedarf somit einer weitgehenden Änderung des Verhaltens unserer Entscheider und von uns selbst.
Ziel sollte sein, einen günstigen Erhaltungszustand wieder herzustellen, und nicht durch weitere menschliche Störeinflüsse zu gefährden.
Standortwahl
Mittlerweile sollte generell von Freiflächenanlagen Abstand genommen werden, da es genügend andere Möglichkeiten gibt um regenerative Energien zu erzeugen, die naturverträglicher sind. So gibt es genügend Potential durch die Nutzung von Dachflächen, Hauswänden, Müllhalden, Konversionsflächen und entlang von Autobahnen ohne Vogelschutzgebiete.
Aussagen der Solarwirtschaft
Da eine PVFA als technische Anlage aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes in der Regel einen Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild darstellen, sollten die Standorte einem qualitativen Mindeststandard entsprechen. Dieser wurde von der Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft (UVS, heute BSW-Solar) und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) im Jahre 2005 in einem Kriterienkatalog ausgehandelt. Darin wurde festgelegt, wo Freiflächenanlagen realisiert werden können. Ein Standort in einem Vogelschutzgebiet wird dort ausdrücklich abgelehnt.
Schlechte öffentliche Publicity
Vor einigen Monaten wurde die PWC-Anlage in unmittelbarer Nähe zum Vogelschutzgebiet am Brandweiher abgelehnt. Ausschlaggebend war, dass die Anlage zu nahe am Neuhauser Wohngebiet geplant war, und dass begründete Auswirkungen u.a. auf den nahegelegenen Brandweiher durch den Naturschutz vorgebracht wurden, und deswegen die Anlage von der Autobahnverwaltung nicht mehr weiter verfolgt werden konnte.
Kriterien des BN zur Photovoltaik
Die Deckung des Energiebedarfs mit regenerativen Energien sollte jedoch nicht durch PV-Freiflächenanlagen, sondern durch die verstärkte Nutzung von ausreichend vorhandenen Dach- und Fassadenflächen, auf versiegelten Flächen oder Konversionsflächen erfolgen [BNPV]. Dazu sollte auch der Landkreis seine, im Klimakonzept 2012 gesetzten Ziele überprüfen und engagierter vorantreiben.
In rechtlich geschützten Naturschutzflächen sollten auch kleinindustrielle Bauten jeglichen Couleurs herausgehalten werden. Dies war und ist schon immer Position des BN bei der Beurteilung von Bauleitplänen.
Zu berücksichtigen ist auch im verstärkten Maße das Naturschutzpotential der Flächen. Nur auf Flächen, die zuvor intensiv genutzt wurden, ist der Bau einer PVFA akzeptabel.
Naturnahe Alternativen
Der BN kann sich aber auch andere „Bewirtschaftungsformen“ vorstellen, die eine Aufwertung für das Gebiet darstellen könnten. So ist das Areal geprägt durch einen hohen Grundwasserstand. Damit wären im Plangebiet auch wechselfeuchte Tümpel möglich, die Knoblauchkröte, Moorfrosch und eventuell sogar Kreuzkröte beherbergen könnten. Ein entsprechender Ausgleich über diverse Vertragsprogramme wäre zu prüfen.
Für Rückfragen:
Helmut König, helmut.koenig@bund.net, 09195/993164
17.06.2018 - Gespräche zur Energiewende mit Mitgliedern des Bundestages
Die Energiewende muss dezentral und regional sein. Darüber sind sich die Vorsitzenden der BN Kreisgruppen Erlangen und Höchstadt-Herzogenaurach, der Energiewende ER(H)langen e.V. und der Bürgergenossenschaft EnergieWende Erlangen und Erlangen-Höchstadt eG (EWERG eG) einig. In zwei Gesprächsrunden haben sie sich mit den lokalen Bundestags-Vertretern darüber unterhalten und um mehr Einsatz für den Paradigmenwechsel geworben.
Die Energiewende muss beschleunigt und vordringlich dezentral auf regionaler Ebene vorangetrieben werden. Das haben die Vorsitzenden der Klimaschutz-, Bürgerenergie- und Umweltverbände in Gesprächen mit den örtlichen Abgeordneten der Berliner Regierungsparteien deutlich gemacht.
Sowohl Martina Stamm-Fibich (SPD) – die vom umweltpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Carsten Träger (Wahlkreis Fürth) begleitet wurde - als auch Stefan Müller (CSU) zeigten sich den Forderungen aufgeschlossen, machten aber zugleich auf mögliche Hürden aufmerksam. Die Vertreter der Umwelt- und Energieverbände machten in den getrennten Gesprächen mit SPD und CDU zwei programmatische Stellungnahmen zur Diskussionsgrundlage: Das 4-Punkte-Papier „Forderungen für den Klimaschutz an die neue Bundesregierung“, das der BN zusammen mit sechs Stadtwerken (darunter die Nürnberger N-Ergie) verfasst hatte, außerdem das Positionspapier des Bündnisses Bürgerenergie mit der Überschrift „Energiewende und Klimaschutz durch lokale Strommärkte“.
Unbestritten war in beiden Gesprächen, dass die dezentrale und verbrauchsnahe Stromversorgung deutliche Vorteile gegenüber einer zentralen mit langen Übertragungsnetzen hat: Die regionale Wertschöpfung wird gestärkt, die Versorgungssicherheit erhöht, die Kosten sind geringer und die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung größer.
Allerdings, auch das war allen Teilnehmern klar, sind die bestehenden Strukturen noch zu sehr auf Zentralisierung ausgerichtet. Außerdem waren sich Stamm-Fibich, Träger und Müller mit den Verbänden darin einig, dass noch offen sei, was unter „regional“ zu verstehen sei. Ist es ein Landkreis, eine Regierungsbezirk, ein Ballungsgebiet? Zu kleinteilig dürfe das Versorgungsgebiet nicht werden, es sollten aber auch keine privilegierten „Inseln“ geschaffen werden. Dass industrielle Ballungsräume energietechnisch nicht autark sein können, war ebenso unbestritten wie die Tatsache, dass nicht ganz Deutschland mit Regionalstrom versorgt werden kann. „So viel wie möglich regional“, fasste Stamm-Fibich zusammen, wobei allen klar war, dass man auf Stromtrassen nicht ganz verzichten könne. Ebenso wenig auf Reservekapazitäten, solange die nötigen Speicher noch aufgebaut werden müssen, weil ja Sonne und Wind nicht immer im gleichen Umfang zur Verfügung stehen.
Biogas sei nicht unumstritten, räumten die Verbände ein, aber zu vertreten, solange man keine Monokulturen vorantreibe – und es sei vor allem wegen seiner Speicherfähigkeiten nötig, wenn der Ausstieg aus der Kohle endgültig vollzogen werde. Der Kohleausstieg ist ein zentraler Punkt des Energiewende-Konzepts, aber wann er vollzogen wird, ist noch offen. Die schwarz-rote Koalition hat bisher lediglich eine Kommission eingesetzt, die das erörtern wird. „Wir werden binnen zwei Jahren einen Ausstiegstermin nennen“, sagte Träger vorsichtig.
Die Hoffnungen ruhen jetzt auf einem zügigen regionalen Ausbau der erneuerbaren Energien. Einen, der neben der Versorgungssicherheit auch der sozialen Gerechtigkeit und den strukturell gefährdeten Arbeitsplätzen Rechnung trägt, worauf die Bürgerenergievertreter und Umweltverbände besonderen Wert legen. Sie sehen zukunftssichere Arbeitsplätze durch den global wachsenden Markt im Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizenz. Daran sollte die Bundesregierung systematisch arbeiten, um die Chancen für die deutsche Wirtschaft nicht zu verpassen, zumal sich zunehmend Vertreter der konventionellen Energiewirtschaft und der Industrie zur Energiewende bekennen und von der Politik mehr Mut und langfristige Konzepte beim Umstieg sowie Planungssicherheit verlangen.
Die Verbände nannten dazu bei den Gesprächen drei aktuelle Bausteine, die dringlich umgesetzt werden müssen: Sonderausschreibungen für Windkraft und Photovoltaik stünden zwar im Koalitionsvertrag, würden aber von der Union blockiert. Diese Maßnahme zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energie müsse noch vor der Sommerpause umgesetzt werden. „Zweiter Punkt ist die mangelnde Unterstützung von so genannten Energie-Prosumern, also Bürgern oder Gruppen, die ihren selbst erzeugten Strom auch selbst nutzen. Nach den Gesprächen mit den MdBs hat die EU am 14.06.2018 gegen den Willen der Bundesregierung nun eine Vereinfachung von Bürger-, Quartiers- und Mieterstromkonzepten in einer Richtlinie beschlossen. „Berlin müsse somit jetzt die Blockade aufgeben und die Umsetzung in nationales Recht zeitnah angehen“, so der Tenor nach dem Beschluss.
Drittens wurden die schon 2016 vereinbarten regionalen Herkunftsnachweise für Strom (Regionalstromkennzeichnung) immer noch nicht eingeführt, die den rechtlichen Rahmen für räumlich dem Verbrauch nahe Erzeugung verbessern würden. Auch da müsse Berlin in diesem Jahr noch handeln.
Gerade die teils massiven Unwetter der letzten Tage und Wochen, haben erneut deutlich vor Augen geführt, dass der Klimawandel längst Realität ist und wir nach Expertenmeinung nur noch wenige Jahre haben, eine völlige Destabilisierung des Klimas zu vermeiden. Insofern muss jetzt alles daran gesetzt werden, die Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen und nicht weiter zu verzögern oder gar zu blockieren.
Feste Zusagen der Gesprächspartner von CSU und SPD gab es allerdings nicht. Müller stellte aber eine Stellungnahme zu den Forderungen in Aussicht. Mit Stamm-Fibich soll es weitere Gespräche geben.
Herbert Fuehr, BN KG Erlangen
Helmut König, BN KG Höchstadt-Herzogenaurach
Stefan Jessenberger, Energiewende ER(H)langen e.V.
Dieter Emmerich, EWERG eG
21.05.2018 - Biotop Kerschensteiner Straße, Höchstadt
BUND Naturschutz und andere Vereine wollen den Erhalt des Biotops südlich der Kerschensteiner Straße und haben eine gemeinsame Pressemitteilung erstellt.
Kellerberg-, Kerschensteiner- und Dr.-Schätzel Straße umschließen einen Obstgarten-Komplex, der seinesgleichen sucht. Breit ist das Artenspektrum. Neben den dominierenden Apfelbäumen sind es vor allem Zwetschgen-, Birn- und Walnussbäume, die den Bestand bilden.
Die Altersstruktur ist durchgehend von jungen Bäumen vor allem im oberen, nördlichen Teil bis zu den Obstbaumriesen im südlichen Teil. Breit gestreut ist auch der Zustand der Wiesenflächen dazwischen: Neben regelmäßig gemähten Flächen sind auch solche, die kaum genutzt werden. Sie lassen Blüte und Samenbildung der Wiesenpflanzen zu.
Die vielfältige Struktur des Areals sorgt für zahlreiche ökologische Nischen, die z.B. für viele Insekten- und Vogelarten wertvolle Refugien bilden. So konnten Ende April (28.04.2018, 10:00 Uhr) in 10 Minuten 12 Vogelarten registriert werden. Insgesamt können auf der Fläche 29 Vogelarten aufgezählt werden. Zu diesem Zeitpunkt der Hochblüte der Apfelbäume wurden die Vogelstimmen eindrucksvoll von dem Fluggeräusch eines Insektenheeres von Bienen, Hummeln und weiteren Bestäubern überlagert.
Aus ökologischer Sicht ist der südliche Teil des Areals der wertvollste Teil. Beherrschend sind hier mehrere gewaltige Apfelbäume mit Stammdurchmessern in Brusthöhe von ½ m und mehr. Ihre Vitalität stellten sie in diesem Frühjahr durch eine einmalige Blütenfülle unter Beweis (NN, 03.05.2018). Gleiches gilt für eine große Traubenkirsche mit ihren zahllosen weißen Blütentrauben. Ein Birnbaum rundet das Bild ab. Unbestreitbarer Star ist ein riesiger, weit ausladender Walnussbaum. Er steht dicht bei den großen Apfelbäumen. Dadurch besteht ein stark beschatteter Bereich mit urwaldähnlichem Aussehen und seinen Elementen: An einem Baumriesen windet sich eine Liane in Form eines üppigen Efeu empor. Am Boden steht ein prächtiger Wurmfarn.
Die Flanken des Grundstücks bilden verschiedene Sträucher: Hartriegel, Holunder, Pfaffenhütchen, Liguster, Süßkirsche und Mirabelle. Sie begrenzen auf zwei Seiten eine Wiese, die zur Apfelbaumblüte Ende April von der Löwenzahnblüte bestimmt wurde. Mitte Mai bilden Scharfer Hahnenfuß und Rotklee den Aspekt. Dazu kamen 5-6 weniger auffällige Blütenpflanzen. Die dominierenden Gräser (Knäuelgras, Fuchsschwanz, Honiggras) zeigen eine gute Nährstoffversorgung an.
Das Obstgartenareal ist ein wichtiges Bindeglied der „Grünachse“, die sich vom Engelgarten über den Kellerberg bis zum Weingartsgraben hinzieht. Sie sorgt für ein „Wohnen im Grünen“ durch eine deutliche Verbesserung der Wohnqualität. Hier seien nur ausgeglichene Temperaturen, Beschattung, Luftfilterung und Lärmdämpfung genannt. Kellerberg- und Heimatverein unterstützen seit langem Erhalt und Verstärkung dieser Grünachse. Das Obstgartenareal ist umso bedeutender, da in diesem Bereich des unteren Kellerberg die mächtigen Alleebäume (Spitzahorn, Esche, Kastanie) beseitigt wurden (1981).
Das Gymnasium ist vor allem nach der Südseite durch den Grünkomplex des Obstgartens gut abgeschirmt, dank einer weitsichtigen Planung. Es ist ein wirksamer Puffer gegenüber den Anliegern an Kellerberg- und Dr.-Schätzelstraße. Für die Schüler und Lehrer des Gymnasiums ist es ein wertvoller grüner Freiraum. Eine geplante Bebauung würde ihn nicht nur weitgehend unwirksam machen oder zerstören, sondern auch gleichzeitig neue Probleme heraufbeschwören. Dass ungefähr 1000 Personen, die zur Schulzeit täglich kommen und gehen stoßweise einen erheblichen Lärmpegel verursachen, ist nicht zu vermeiden. Dies würde mit Sicherheit bei manchen der neuen Nachbarn zu Ärger und entsprechenden Reaktionen führen. Hierzu käme, dass die jetzige Parknot in der Kerschensteiner Straße sich kaum noch beherrschen ließe.
Wie sich zukunftsorientierte Städte, wie unsere Nachbarstädte Erlangen oder Nürnberg, sich um mehr Grün in ihrem Wohngebieten bemühen, war hochaktuell in einer lokalen Zeitung nachzulesen (NN, 03.05.2018, S13). Unter der Überschrift „Mangel an Grün“ wird berichtet, dass der Nürnberger Stadtrat die Mittel für den Kauf von Grün- und Freiflächen gegenüber dem letzten Jahr um das 12,5-fache auf 1 Million Euro erhöht hat – und zwar einstimmig. Überzeugender kann man die Bedeutung von „Grün in der Stadt“ nicht unterstreichen.
Angesichts dieser sinnvollen Trends kann man beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie man hier in Höchstadt bei dem gewaltigen Flächenverbrauch vor allem im Industrie- und Gewerbekomplex auf kaum umstrittenen Gelände für den Bau mehrerer Wohnblöcke die Entwertung und Vernichtung eines wertvollen Obstgartens mit leistungsstarken Biotopen im intakten Wohngebiet ins Auge fassen kann.
16. Mai 2018
gezeichnet
Helmut König, Bund Naturschutz, Kreisgruppe, 1.Vorsitzender
Dr. Hans Krautblatter, BN Ortsgruppe Höchstadt, Biologe
Herbert Lawrenz, Obst- und Gartenbauverein Höchstadt, 1. Vorsitzender
Benjamin Wiese, Imkerverein Höchstadt, 1. Vorsitzender
Karsten Wiese, Kellerbergverein, 1. Vorsitzender
Christoph Reuß, BN Ortsgruppe Höchstadt, Ortssprecher
Irmgard Schlehlein, Industriefachwirtin
und weitere
19.05.2018 - Schreiben an Bürgermeister Brehm - Biotop Kerschensteiner Straße, Höchstadt
In einem Schreiben vom 19.05.2018 an den Bürgermeister Gerald Brehm der Stadt Höchstadt weist der BN auf die Schutzwürdigkeit eines Obstgartenkomplexes hin, eingeschlossen von Kellerberg-, Kerschensteiner- und Dr.-Schätzel Straße, der in der Stadt einzigartig ist. Neben den dominierenden Apfelbäumen sind es vor allem Zwetschgen-, Birn- und Walnussbäume, die den Bestand bilden, und so einem breiten Artenspektrum ein einzigartiges Biotop bilden. Nachfolgend wird das Schreiben veröffentlicht.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brehm,
der BUND Naturschutz (BN) bittet Sie, von der Bebauung des Gartengrundstückes südlich der Kerschensteiner Straße abzusehen. Um das Areal in seiner Wertigkeit noch zusätzlich zu steigern könnte auch der nebenliegende Hartplatz als Grünfläche ausgewiesen, und mit jungen Bäumen bepflanzt werden.
Durch einen Artikel im Fränkischen Tag Mitte März 2018 und durch naturbewusste Anlieger wurden wir auf den Vorgang aufmerksam, und haben das Thema vor kurzem wieder aufgegriffen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit anderen Höchstadter Vereinen, die diesem Schreiben beiliegt versuchen wir Ihnen die Schutzwürdigkeit des Areals darzulegen. Außerdem hatten wir bereits im Jahr 2016 veranlasst, den Garten fachlich zu untersuchen. Das Kurzgutachten unseres Kreisvorstandsmitgliedes Dipl.-Forsting. Hartmut Strunz, als auch die Bewertung der Unteren Naturschutzbehörde durch Herrn Sehm liegen dem Schreiben bei.
Wir sind verwundert, dass diese Informationen den Stadtrat offenbar nicht erreicht haben, obwohl das Kurzgutachten auch Ihrer Stadt bekannt sein müsste.
Ich möchte nicht die Fakten, die bereits in den Anlagen beschrieben sind wiederholen (siehe PM), sondern lediglich noch etwas ergänzen.
Der BN unterstützt Ihre Bemühungen, Flächen im Innenbereich nach zu verdichten. Jedoch sollten absolut schutzwürdige Bereich davon ausgenommen sein. Natur und Mensch profitieren von einer Vielzahl kleinster Lebensräume, die neben Insekten auch Vögel anziehen. Der massive Rückgang beider Klassen ist allgemein bekannt. Dieses Gartengrundstück zählt in hohem Maße zu solch einem wertvollen Gebiet, weshalb es als Stadtbiotope unbedingt zu schützen ist. In Zeiten, in denen die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher spürbar werden, haben Grünflächen, und vor allem die Bäume eine immer größere und überlebenswichtige Bedeutung für Mensch und Tier. Es ist obendrein absolut sinnvoll, Residualbiotope in der Stadt zu erhalten bzw. neu zu schaffen, die netzwerkartig Insekten und Vögeln naturbelassene Flächen als Brut- und Nahrungsgebiete anbieten.
In einem kurzen Gespräch unter Vogelkennern konnten in kurzer Zeit 27 Vögel aufgeführt werden, die dort in jüngster Zeit gesichtet bzw. gehört wurden. Einige Durchzügler wurden dabei nicht aufgeführt.
Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, Distelfink, Dompfaff, Eichelhäher, Elster, Gartenbaumläufer, Girlitz, Goldammer, Grünfink, Grünspecht, Hausrotschwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rauchschwalbe, Rotkehlchen, Türkentaube, Wendehals, Zaunkönig.
Als absolutes Highlight muss der Wendehals erwähnt werden. Eine Rote Liste Art, die vom Aussterben bedroht ist (RL1), und auch im naheliegenden Weingartsgraben gesichtet wurde.
In dem Gartengrundstück wurden auch Fledermäuse gesichtet. Aufgrund der Habitatbäume muss sichergestellt werden, dass keine Bruthöhlen zerstört werden. Damit wird angezweifelt, dass ein vereinfachtes Verfahren nach §13a BauGB überhaupt angewendet werden darf. Um die Bestimmungen des §44 BNatSchG zu erfüllen, ist eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung notwendig.
In Höchstadt existieren genügend Bauflächen, die eine entsprechende Bebauung ermöglichen sollten. Wir bitten Sie daher eindringlich von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.
gezeichnet Helmut König
Dem Schreiben liegen ein Kurzgutachten von Hartmut Strunz, Forstoberrat i.R. und ein Schreiben von Andreas Sehm, Unteren Naturschutzbehörde ERH bei. Siehe auch Pressemitteilung vom 21.05.2018.
Für Rückfragen:
Helmut König, helmut.koenig@bund.net, 09195/993164
18.04.2018 - BN Mitgliederversammlung in Niederndorf
Am 18.04.2018 fand die Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe des Bund Naturschutzes (BN) in der ASV Sportgaststätte in Niederndorf statt.
Aktuell hat die BN Kreisgruppe 1563 Mitglieder. An Grundbesitz werden 16,4 Hektar an Wiesen und Teichen ausgewiesen, 4,9 Hektar sind noch dazu gepachtet. Der Ertrag am Karpfen pur Natur, der ohne Zufütterung in naturnahen Weihern aufwächst, war gegenüber 2017 um 50 Prozent geringer.
Insgesamt betreut der BN im westlichen Landkreis 9 Amphibienübergänge. 48 Sammler tragen täglich Amphibien über die Straße. 2017 waren es insgesamt an die 15.000 Tiere. Auch eine hohe Zahl an Versammlungen, Exkursionen, Vorträgen wurden geleistet.
Im Vortrag des Kreisvorsitzenden Helmut König wurde auch eine Vergleichsstatistik gezeigt, die 2017 eine Zunahme an Amphibien aufweist. „Aufgrund des Wassermangels der letzten Jahre und eines abgelassenen Teiches, der die Amphibien aufnehmen sollte, wird aller Voraussicht die Population in den nächsten Jahren wieder zurückgehen“, ist sich König sicher.
Im Sommer 2017 wurde eine EU-Vertragsverletzungsanmahnung vorbereitet, die mehr Schutz für die Brutvögel in Vogelschutzgebieten im Wald anmahnte. Im Frühjahr wurde nochmals ein Gespräch mit den Forsten (BaySF Forchheim) und dem AELF (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) gesucht, welches positive Ergebnisse erbrachte. „Für die dort geschützten Tiere ist nun geplant, Strukturverbesserungen und Lebensräume zu prüfen und dann zu sichern“, so König. „Dieses Zugeständnis unterstützen wir auch, indem wir an einen Abend mit Mitgliedern eine Verhörung im Staatswald zwischen Röttenbach und Baiersdorf durchführen, um den aktuellen Stand an Ziegenmelkern (ein Vogel, der vom Aussterben bedroht ist) heraus zu finden.“ Hartmut Strunz, der Förster im Kreisvorstand, wird die Schulung der Mitglieder übernehmen.
Im Herbst wurde eine große Ausstellung im Schloss Adelsdorf durchgeführt, die Klima und Energiewende zum Thema hatte. Über zwei Wochenenden, einschließlich der Werktage dazwischen wurde die Bevölkerung und Schulen von zwei Ingenieuren informiert. Dazu wurden gängige Ausstellungen des Umweltministeriums eingesetzt, als auch viele Zusatzinformationen durch die Ortsgruppe Adelsdorf aufbereitet. „Auch 2018 im September werden wir diese Ausstellung nochmals mit Erweiterungen anbieten, da das Informationsdefizit zu Klima und Energie noch verringert werden kann“, erläutert König. Zum gleichen Thema fanden auch Gespräche mit Bundestagsabgeordneten der SPD statt, in Kürze auch mit der CSU. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dezentraler Energieversorgung und dem Kohleausstieg.
Auf die aktuell laufende Aktion „Hilfe für Kiebitze“ der Kreisgruppe mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde hingewiesen. Das insgesamt auf fünf Jahre angesetzte Projekt soll dem gravierenden Rückgang der Wiesenbrüter Einhalt gebieten. „Erst Ende des Monats kann eine erste Bilanz gezogen werden“, meint König. Aber wohl nicht recht positiv. Er ist sicher, dass das gezeigte Engagement der aktuell 19 Standbeobachter spätestens in vier Jahren auch seine Erfolge feiern wird. „Momentan erhalten wir eine gute Übersicht über die Aktivitäten der Vögel im Landkreis“.
Im Frühjahr 2017 wurden die Rammlerweiher im Naturschutzgebiet Mohrhof nach 50 Jahren durch den BN mit Unterstützung des Landschaftspflegeverbandes wieder reaktiviert. Die beiden Teiche sollen rein dem Naturschutz überlassen werden, also ohne Karpfenbesatz. Der Unterwasserbewuchs wurde durch Fachleute bereits als vielversprechend bewertet.
Ein Hauptpunkt war die Südumfahrung Niederndorf-Neuses. Der Kreisvorsitzende bedankte sich für den Einsatz der Ortsgruppe Herzogenaurach für die Öffentlichkeitsarbeit durch Begehungen und Infostände. Das Gutachten von RegioConsult, das die Kreisgruppe erstellen ließ, „hat nichts mit einer Verzögerungstaktik des BN zu tun, wie der Bürgermeister vorschnell am gleichen Tag der Übergabe des Gutachtens an die Stadt Herzogenaurach äußerte, sondern ist das Bestreben, weg vom individuellen Straßenverkehr zu mehr öffentlichem Nahverkehr zu kommen“, so König.
Im Anschluss berichtete die Geschäftsführerin der Kreisgruppe, Andrea Wahl über die Aktivitäten in den Ortsgruppen. Alles zusammen zeigt der BN im Landkreis eine hohe Präsenz und viele Aktivitäten auf.
Danach folgte der Kassenbericht durch Christoph Reuß. Am Ende gab es einen Vortrag durch die Referentin für Landwirtschaft im BN, Frau Marion Ruppaner. Ihr Thema war „Gut und gesund essen, verantwortlich produzieren und einkaufen“.
Im Vorabendprogramm ab 18:00 Uhr wurde eine kurze Begehung der Südtrasse nahe des Niederndorfer Biotops durchgeführt. Diese endete pünktlich zum Beginn der Jahreshauptversammlung.
14.03.2018 - Hilfe für Kiebitze - Start eines mehrjährigen Naturschutzprojektes
Seit mehreren Jahren stellen der BUND Naturschutz (BN) als auch die Behörden fest, dass die Anzahl unserer Wiesenbrüter im Aischgrund, der Reichen Ebrach und im Seebachgrund dramatisch abnehmen. Daher hat sich aus einer Initiative der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landratsamtes und der Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des BN eine „Hilfe für Kiebitze“ entwickelt, die rechtzeitig zur Rückkehr der Kiebitze nun ihre Arbeit aufgenommen hat.
Die treibenden Personen für dieses Projekt sind Andreas Sehm (UNB) und Helmut König (BN). Sehm zeichnet für die Finanzierung des Projektes, König für die organisatorische Durchführung.
Der Grundgedanke dabei ist folgender: Über sogenannte Standbeobachter, also Personen, die sich an einigen Tagen der Woche von März bis April bereiterklären, auf frühmorgendliche Balzflüge von Kiebitzen in definierten Arealen zu achten, werden die Basisdaten möglicher Standorte für Brutflächen gesammelt. Anhand der gemeldeten Balzflüge finden anschließend die Ornithologen, alles qualifizierte Fachleute, die Brutplätze der Vögel heraus und melden sie an die UNB. Stimmt der Landwirt zu, dass das Nest markiert werden darf und er um die markierten Stellen beim Eggen, Säen oder anderen Bearbeitungen einen Bogen macht, erhält er dafür einen Ausgleich. Der entstehende Produktionsausfall wird ihm finanziell ersetzt. Die Vergütung liegt dabei erheblich über seinem Verlust.
Im Bereich von Mühlhausen über Baiersdorf bis Kairlindach werden 8 Areale beobachtet. Es werden nur Brutplätze auf Ackerflächen beachtet. „Dabei ist das Betreten der Äcker durch die Beteiligten ohne Zustimmung des Landwirts absolut verboten“, betont Sehm ausdrücklich.
In einer gemeinsamen Informationsveranstaltung im Landhotel Drei Kronen in Adelsdorf Mitte Februar mit bisher 35 beteiligten Akteuren aus 32 Standbeobachtern, drei Ornithologen sowie den Administratoren Sehm und König wurden die Grundzüge erläutert. König hat für die Beobachtung ein Online System des NABU, den naturgucker ausgewählt, und diesen so angepasst, dass er für die einzelnen Gruppen als Beobachtungs- und Auswertesystem optimal eingesetzt werden kann. „Durch Setzen von Filtern und Freunden - das sind die Mitbeobachter in einem Gebiet - können die Beobachtungen erheblich übersichtlicher verwaltet werden.“ erläutert König. Dafür hat er sogar eine eigene Bedienungsanleitung für die Beteiligten geschrieben. Über eine Aktivitäten-Liste mittels eines weiteren Online-Tools können die Teilnehmer in ihrem Areal die Beobachtungen koordinieren. Mündliche Absprachen sind aber weiterhin möglich.
„Mittlerweile sind die Kiebitze in unserem Landkreis eingetroffen, und wurden schon zu hunderten auf ihren Rastplätzen gesichtet. Viele fliegen weiter, aber etliche bleiben auch hier, und verteilen sich in den nächsten Tagen im Landkreis.“ erklärt der Ornithologe und Landwirt Thomas Stahl.
Alle Beteiligten hoffen, durch diese Aktion dem Nachwuchs dieser hochgefährdeten Vögel wieder zu mehr Überlebenschancen zu verhelfen. „Durch einen Anstieg an Kiebitzen werden wir sicher auch wieder einen Zuwachs noch gefährdeterer Arten wie Brachvogel, Uferschnepfe und Bekassine erreichen“, hofft König.
Mehr Informationen über die Aktion „Hilfe für Kiebitze“ sind unter hoechstadt-herzogenaurach.bn.de zu finden.
Für Rückfragen:
Helmut König, helmut.koenig@bund.net, 09195-993164
Andreas Sehm, andreas.sehm@erlangen-hoechstadt.de
21.01.2018 - Ernsthafte Bewertung der Aurachtalbahn
Der BN appelliert an Bürgermeister und Stadträte der Stadt Herzogenaurach, die Aurachtalbahn ernsthaft zu prüfen. Eine Pro-Forma-Prüfung nützt nicht einer nachhaltigen Verkehrsstrategie fόr Herzogenaurach fόr die nächsten Jahrzehnte.
In Bürgerversammlung am 05.12.2017 stimmte die Mehrheit der anwesenden Bürger für den Antrag, die Aurachtal Bahntrasse einer ernsthaften Bewertung zu unterziehen. Das fordert auch der BN, die Regierung von Mittelfranken, und wohl auch ein großer Teil der Bevölkerung.
Der BN bittet um eine belastbare Neubewertung für ein Gesamtkonzept eines öffentlichen Nahverkehrs, bei der die Bahntrasse ein wesentlicher Teilbereich ist. Für die Entscheidung der Zustimmung zu einer belastbaren Neubewertung verweist der BN auf eine kursierende 24-seitige Projektstudie eines ausgewiesenen Bahn-Experten (dem Stadtrat und der Presse bekannt), die wesentliche Fakten zur Bahntrasse aufzeigt.
- Der Betrieb einer Schienen-Bahn auf der Bestandstrasse ist hochwirtschaftlich, und dies bereits auf Basis der Daten der StUB-Studie von 2012 (sogar noch ohne Berücksichtigung des Siemens-Campus). Die dort ausgewiesenen Nutzerzahlen (5.000/Tag) übersteigen bei weitem die Zahlen vieler Regionalbahnen.
- Die Taltrasse ist zu einem Bruchteil der StUB Kosten im niedrigen einstelligen Prozentbereich wiederherstellbar, deutlich weniger als z.B. das geplante Bürgerzentrum gekostet hätte.
- Zu diesen Bruchteilkosten in Größenordnungen, die von der Stadt auch allein zu stemmen wären, wäre eine Bund/Länder Förderung wahrscheinlich, da bzgl. des Nutzen/Kosten Indikators eine Marke von mind. 1,0 erwartbar ist.
- Der Autor des Projektpapiers sieht die Option einer Kombination mit der StUB L-Variante mit einer Tal S-Bahn als ein sich gut ergänzendes Angebot, final sogar mit einem Ringschluss.
- Es ergeben sich weitergehende Zukunftsperspektiven mit Fortsetzung der Taltrasse im Aurachtal.
Auch die Verkehrsprobleme im Osten von Herzogenaurach verlangen zunehmend Lösungen. - Eine Realisierbarkeit und damit vorzeitige Verkehrsentlastung wäre bereits innerhalb von 5 Jahren möglich, da sich die Grundstücksfrage weitgehend nicht stellt.
- Mit Siemens Mobility vor der Haustür bestehen beste Bedingungen zum Einsatz neuester Technologien,
in der Studie gibt es vielerlei Details dazu.
Der BN appelliert an die Stadträte: Entscheiden Sie für ein Verkehrskonzept für Herzogenaurach, das die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit bewertet. Aus unserer Sicht ist das Festhalten am Individualverkehr und einem weiteren Straßenbau kein nachhaltiges Zukunftskonzept.
Stimmen Sie für eine aussagekräftige Bewertung der Bestandstrasse nach dem standardisierten Verfahren, um ein effizientes und zukunftsfähiges Verkehrskonzept für Herzogenaurach zu erhalten.
Für Rückfragen:
Helmut König, 1. Vorsitzender Kreisgruppe
Dr. Horst Eisenack, 2. Vorsitzender Ortsgruppe Herzogenaurach
01.01.2018 - Widerspruch gegen Eisenbahn-Bundesamt
Der BN hat Ende Dezember 2017 Widerspruch gegen die Freistellung von Teilen der Aurachtal-Bahnstrecke bei Herzogenaurach beim Eisenbahn-Bundesamt (Bescheid vom 20.12.2017) eingelegt.
Entgegen des Bescheides des Eisenbahn-Bundesamt in Nürnberg sind wir der Auffassung, dass die Begründung der Landesplanerischen Beurteilung der Regierung von Mittelfranken zum Raumordnungsverfahren (ROV) der Südumfahrung Niederndorf-Neuses nicht gerecht wird. Außerdem wird das Ergebnis einer noch ausstehenden Prüfung einer Alternativstrecke im Planfeststellungsverfahren zur Südumgehung Niederndorf-Neuses durch die Stadt Herzogenaurach vorweg genommen.
In der Landesplanerischen Beurteilung wird bereits im Gesamtergebnis auf Seite 1 folgendes festgehalten: Die Ortsumfahrung ist so zu gestalten, dass die Einrichtung einer Stadt-Umland-Bahn möglich ist. Darüber hinaus sind die Kreuzungspunkte mit der ehemaligen Bahnlinie Erlangen-Bruck Herzogenaurach so auszuführen, dass bei Bedarf zukünftig ein elektrischer Betrieb der Linie hergestellt werden kann. Dies impliziert ausdrücklich auch einen Bahnbetrieb, der bei gerechtfertigter und kostengünstigerer Nutzung als Personen- oder/und Güterverkehr zu berücksichtigen ist.
Nun hat die Stadt Herzogenaurach in einem früheren Ratsbeschluss außerhalb des Bauleitverfahrens beschlossen, die Nutzung der Aurachtalbahn-Trasse nicht weiter zu verfolgen. Dies war in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass aus Sicht der Stadträte ökonomisch wie ökologisch mögliche, aber aus Rücksicht auf die Firma Schaeffler nicht gewollte Varianten frühzeitig aussortiert wurden. Im ROV wurden nicht mögliche Alternativen, sondern lediglich wenig differenzierte Varianten von fast gleichlaufenden Straßenverläufen einer Prüfung unterzogen.
Erst im November 2017 kam der Stadtrat zu der Einsicht, dass dieses Verhalten eventuell Probleme in Bezug zu der Auflage der Landesplanerischen Beurteilung, und somit auch mit dem Raumordnungsgesetz ergeben könnte. Der Herzogenauracher Stadtrat beschloss daher, diese notwendige Alternative nachzuholen, indem ein Auftrag über 160.000 EUR an ein Planungsbüro erging (Pressemitteilung Nordbayerische Nachrichten, 17.11.2017, Talvariante wieder auf dem Tisch: Eine Prüfung ist erforderlich), um ein entsprechendes Gutachten noch erstellen zu lassen. Aus unserer Sicht ist dieser Sinneswandel nicht einer tatsächlichen Aufklärung geschuldet, sondern dient lediglich dazu, die rechtlichen Auflagen zu erfüllen.
Eine nicht unerhebliche Wirkung hat daher auch der Bescheid zur Freistellung der Bahnlinie durch das Eisenbahn-Bundesamt. Es besteht die Gefahr, dass das Ergebnis der neuen Untersuchung dadurch bereits in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Das kann und sollte nicht im Sinne des Raumordnungsgesetzes sein.
Auch wird die Variante einer StUB oder Bahnlinie über Erlangen Hauptbahnhof-Bahnhof Bruck-Bahnhof Frauenaurach-Bahnhof Herzogenaurach in den Untersuchungen zur StUB von 2012 mit den aktuellen Gegebenheit eines neu entstehenden Siemens Campus im Süden Erlangens überhaupt nicht berücksichtigt. Wegen der sich damit ändernden Streckenbelastungen (Personen/24h) für eine Bahn- oder StUB-Verbindung über das bestehende Bahngleis ist eine Neubewertung des Nutzen-Kosten-Indikators selbst für die StUB unumgänglich, will man den Bürgern eine faktenbasierte Grundlage für ihre Kostenbeteiligung liefern. Und damit könnte auch das Bahngleis wieder benötigt werden, zeigt doch die Nutzen-Kosten-Untersuchung für die StUB nach dem Standardisierten Bewertungsverfahren ab Bahnhof Herzogenaurach eine höhere Streckenbelastung (in Personen/24h) als der StUB-Zweig bis Büchenbach.
Solange diese Entscheidung nicht getroffen ist, sollte auch die Freistellung nicht erfolgen. Der BN bittet daher, den Bescheid unter Berücksichtigung dieser Punkte nochmals zu prüfen und zurückzuziehen.
Für Rückfragen:
Helmut König, 1. Vorsitzender Kreisgruppe
Dr. Horst Eisenack, 2. Vorsitzender Ortsgruppe Herzogenaurach
05.12.2017 – Maßnahmen zum Baugebiet „Neuhaus Nordwest“
In seiner Stellungnahme befürwortet der BN grundsätzlich die Wandlung des Gewerbebereichs südlich der Neuhauser Schlossweiher in ein Wohngebiet (WA), und die damit einhergehende Reduzierung der Versiegelung. Trotzdem müssen einige wesentliche Gesichtspunkte und Forderungen beachtet werden.
Wie in der Begründung von FNP und BBP angeführt, liegt in weniger als 100m die Neuhauser Schlossweiher, ein Teilgebiet des Natura 2000 Gebietes Aischgrund. Diese Teilfläche ist sowohl Vogelschutzgebiet (SPA) als auch Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH). Der Bereich zeichnet sich durch eine reiche und teils störungsempfindliche Vogelwelt aus, wie sie nur an wenigen Stellen unseres Landkreises noch zu finden ist.
In der genannten Entfernung beginnt der Schilfgürtel um den südöstlich gelegenen Teil des Neuweihers. Dieser Schilfgürtel schützt den sehr sensiblen Bereich dieses Weihers. Für einige seltene Vogelarten ist das Vogelschutzgebiet als Brutgebiet von nationaler Bedeutung. In den Schlossweihern brüten Vögel mit höchstem Schutzstatus. Dazu zählen Arten, von denen in Bayern nur mehr 14-16 Individuen existieren, etliche haben Gefährdungsstatus 1, also "Vom Aussterben bedroht".
Bisher ist eine Einsicht in die Brutzonen nur über den begehbaren Weg im Weihergebiet westlich entlang des Großen Mühlweihers möglich. Durch das schnell wachsende Schilf entlang des Weges im Frühjahr, und einem Abstand von ca. 180m werden Störungen jedoch niedrig gehalten. Es wäre aber äußerst problematisch, würden Störungen von außen in den Weiherbereich eindringen. Dies könnte passieren, wenn eine verstärkte Frequentierung des südlichen Weiherrandes durch die neu angrenzenden Wohnbereiche mit einer erheblichen Zunahme an Bewohnern eintreten würde.
Des Weiteren ist zu beachten, dass im Natura 2000 Gebiet laut dieser EU-Verordnung keine Verschlechterungen eintreten dürfen. Aus den genannten Gründen hat die Gemeinde Adelsdorf Sorge zu tragen, dass keine Störungen in das Weihergebiet eingetragen werden, und das Verschlechterungsgebot eingehalten wird.
Wir empfehlen daher folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:
- Es muss sichergestellt werden, dass das südliche Ufer des Neuweihers für die Öffentlichkeit unzugänglich bleibt. Eventuell wäre auch eine Gebüschreihe möglich, die jedoch nicht hoch werden darf.
- Zufahrt und Zutritt zum Regenüberlaufbecken muss für die Allgemeinheit verboten werden.
- Der nicht befestigte Weg am Westrand des Areals sollte aufgelassen, und die Lücken der bereits bestehenden Sträucher durch zusätzliche Sträucher geschlossen werden.
- Selbstverständlich muss auch gelten, dass im Weiherbereich und dessen Umgriff Hunde nur an der Leine geführt werden dürfen. Während der Brutzeit sollten Hunde am besten nicht mitgeführt werden. Dämme dürfen nicht betreten werden.
Werden keine Maßnahmen zur Reduzierung einer Betretungsgefahr vorgenommen, fordern wir eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung, da damit bereits die Möglichkeit einer Beeinträchtigung bestehen könnte. Es muss gewährleistet werden, dass die Verschlechterung der Lebensräume für die Vogelarten sowie Störungen vermieden werden.
Helmut König
1. Kreisvorsitzender
07.06.2017 - BN Information zu Johannisfeuern
Bald schon stehen die großen Johannisfeuer vor der Tür. Damit nicht nur wir Menschen Spaß daran haben, sollten zum Schutze der Tiere und der Vegetation einige Regeln eingehalten werden.
Die aufgeschichteten Holzhaufen dienen vielen Tieren als Zufluchtsmöglichkeit. Igel nutzen solche Aufschüttungen gerne als Unterschlupf, wenn diese schon länger an Ort und Stelle liegen, sogar als Kinderstube. Wird der Haufen angezündet, sterben sie qualvoll. Igel besitzen keinen Fluchtreflex, bei Gefahr rollen sie sich einfach ein und verharren bewegungslos.
Der grausame Feuertod von hilflosen Igeln (und anderen Asthaufenbewohnern wie Vögeln, Amphibien, Schlangen) kann aber auf einfache Art vermieden werden. „Sammeln Sie die Asthaufen neben der eigentlichen Feuerstelle und schichten Sie diese erst am Tag der Feier zum Beispiel in einer Gemeinschaftsaktion kurz vor dem Entzünden an Ort und Stelle zur eigentlichen Feuerstelle auf“, empfiehlt Andrea Wahl, die Geschäftsführerin der Bund Naturschutz Kreisgruppe.
Außerdem darf ein solches Feuer grundsätzlich nur auf weitgehend vegetationslosen Flächen abgebrannt werden. Auch auf nötige Abstände zu Feldgehölzen, Streuobstbäumen und Hecken ist zu achten. Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz verwendet werden."Werden diese Aspekte beachtet, dann steht einem gelungenen Johannisfeuer auch aus naturschutzrechtlicher Sicht nichts mehr im Wege", so Andrea Wahl.
Andrea Wahl
Geschäftsführerin BUND Naturschutz
Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach
31.05.2017 - Verstoß gegen EU-Vogelschutzrichtlinie - BN will sich in Brüssel wehren
Verstoß gegen die Vogelschutzrichtlinie
Vertragsverletzungsanmahnung wird vorbereitet
Die Kreisgruppe Höchstadt-Herrzogenaurach des Bund Naturschutz (BN) bereitet eine Vertragsverletzungsanmahnung an die EU-Kommission vor. Grund ist die mangelhafte Umsetzung von EU-Richtlinien in den bayerischen Staatsforsten – zuletzt durch den Staatsforstbetrieb Forchheim.
Der Staatsforstbetrieb Forchheim führte bis in den April 2017 hinein umfangreiche Holzernteaktionen im Markwald, einem gemeindefreien Gebiet zwischen Röttenbach und Baiersdorf, durch. Auch die Holzabfuhr ist noch nicht abgeschlossen. Das etwa 2.200 ha große Waldgebiet ist durch die EU-Vogelschutzrichtlinie besonders geschützt.
Ziel dieser Richtlinie ist es, heimische Vogelarten in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten. Dazu gehört vor allem, dass die Vögel besonders während ihrer Brut- und Aufzuchtzeit weder gestört noch beunruhigt werden dürfen.
Mehrmalige Anregungen des Bund Naturschutz, die Holzernte wenigstens während der Vogelbrutzeit ab Anfang März auf die restlichen etwa 15.000 ha des Staatsforstbetriebes zu beschränken, führten bisher zu keinem Ergebnis.
Im benachbarten Staatsforstbetrieb Nürnberg, zu dem das Vogelschutzgebiet Nürnberger Reichswald gehört, haben in den letzten Jahren solche wiederholten Missachtungen der Vogelbrutzeit z.B. im Naturschutzgebiet Brucker Lache bei Erlangen zu massiven Protesten geführt. Nachdem dort das rücksichtslose Vorgehen der Staatsforsten sogar von der Aufsichtsbehörde (Amt für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft) und der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Mittelfranken unbeanstandet blieben, hat die BN Kreisgruppe in ihrer letzten Vorstandssitzung beschlossen, in den kommenden Wochen eine Vertragsverletzungsanmahnung bei der EU-Kommission in Brüssel vorzubereiten.
Damit soll erreicht werden, dass die europaweit geltenden Naturschutzregelungen auch im Vogelschutzgebiet Markwald im Bayerischen Staatsforstbetrieb Forchheim eingehalten werden.
28.05.2017 - Keine Freistellung für das DB-Gleis zu Schaeffler
Die Kreisgruppe setzt sich für ein nachhaltiges, umweltfreundliches, öffentliches Verkehrssystem in Herzogenaurach ein. Aus diesem Grund lehnt der BN eine weitere Umgehungsstraße im Süden Herzogenaurachs ab. Um dies zu erreichen, müssen alle vorhandenen Möglichkeiten konzertiert wirken können, und dürfen nicht von vornherein beschnitten werden.
Durch die Freistellung der Bahngleise vor dem Schaeffler-Tor wird eine Verkehrssituation festgeschrieben. Sowohl Personenzüge wie auch Güterzüge können bei der angedachten, aktuellen Planung nicht mehr betrieben werden, ohne umfangreiche Umbauarbeiten an den Gleisübergängen durchzuführen, damit die erforderliche Durchfahrtshöhe bereitgestellt werden kann. Nachträgliche Umbauten sind äußerst kostenintensiv.
Dies ist aus Sicht des BN nicht zukunftsfähig. Mittlerweile plädiert selbst der Bayerische Städtetag, stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen. Auch bei der Firma Schaeffler ist Umweltschutz Bestandteil ihrer Führungsleitsätze. Leider aber noch nicht bezüglich Verkehr.
Für den BN ist es absolut fragwürdig, dass die Firma den Gleisanschluss, der direkt in das Werksgelände führt, (noch) nicht nutzt. Der BN ist der Meinung, dass mit fortschreitender Überlastung unserer Straßen umweltfreundliche Unternehmen auch in diesem Punkt umdenken müssen. Das Zweigwerk in Wuppertal ist da schon einen Schritt voraus, und man findet die dort vorhandene Schwebebahn als einen Pluspunkt im Wuppertaler Verkehrskonzept.
Die Schaeffler AG stellt dort Teile zur Aufhängung der Schwebebahnen in den Schienen her. "Uns verbindet eine lange Erfolgsgeschichte mit der Wuppertaler Schwebebahn", ist eine Äußerung des Unternehmenssprechers. Auch der Leiter des dortigen Werkes offenbart: Die Wuppertaler Schwebebahn ist einmalig auf der Welt, und wir sind stolz darauf, mit unseren Wälzlagern und Komponenten zu einem zuverlässigen und sicheren Betrieb beizutragen. In Herzogenaurach sind moderne Transportsysteme noch nicht diskutabel.
Der BN hat die Hoffnung, dass auch Schaeffler in Herzogenaurach eines Tages seine Meinung bezüglich Individualverkehr und Lastentransport ändert, dann aber an kurzsichtigen Entscheidungen früherer Stilllegungen daran gehindert wird.
Die Ablehnung ist auch Ausdruck des BN, gegen das vorherrschende Verkehrskonzept der Regierung zu demonstrieren, dass es so nicht weitergehen kann. Die Straße wird zurzeit "dobrintisiert". Anstatt aus Umweltgründen den öffentlichen Verkehr massiv zu stärken, lässt die Politik es zu, immer mehr Verkehr auf die Straße zu bringen, zum Leidwesen der gesamten Bevölkerung.
Auch ist es ein Trugschluss zu glauben, wenn eine weitläufige Südumfahrung vorhanden ist, dann sind die Probleme gelöst. Sie sind damit nur in die Zukunft verschoben, denn früher oder später sind dann andere die Betroffenen, die über Lärm, Gestank und Schadstoffe klagen werden.
Für Rückfragen:
Helmut König, 1. Kreisvorsitzender
26.03.2017 - BN Mitgliederversammlung in Gremsdorf
Die Jahreshauptversammlung der Bund Naturschutz Kreisgruppe fand heuer in Gremsdorf statt. Der Ort war ausgewählt, da neben Herzogenaurach auch hier gravierende Probleme mit Umgehungsstraßen bestehen.
Bevor man aber zu diesem Thema kam, stellte der Kreisvorsitzende Helmut König die mannigfaltigen Aktivitäten im Kreis, wie in den Ortsgruppen dar. Herausragend war die Reaktivierung der Rammlerweiher im Naturschutzgebiet Mohrhof. Insgesamt fanden 88 Veranstaltungen statt, darunter zwei Demonstrationen. Damit war man beim Problem des Verkehrs angelangt. Grundsätzlich warb der Kreisvorsitzende für eine Rückbesinnung auf alternative, öffentliche Verkehrsstrukturen. „Nur so kann der Verkehr reduziert werden“, so König.
Dies bestätigte dann auch Gernot Hartwig, Sprecher des Arbeitskreises Verkehr im BN. Denn „die Planer gehen von stetig steigendem Verkehr aus. Wenn deshalb neue Straßen gebaut werden, entsteht nur noch mehr Verkehr“, so der Gemeinderat aus Buttenwiesen südlich von Donauwörth.
Verkehr sei eine Folge politischer, oft recht kurzsichtiger Entscheidungen. Während im österreichischen Vorarlberg amtlicherseits bereits heute mit jährlicher Verkehrsreduzierung geplant werde, sei man hierzulande davon noch weit entfernt. Straßen würden heute immer noch so geplant, als wäre kein Wandel im steigenden Ölpreis oder dem Umstieg auf andere Mobilitätskonzepte absehbar.
Artensterben, Landschaftszerstörung, Stau, Parknot in Städten, Straßenunterhalt werden "nicht geringer, der Verkehr nicht billiger, wenn er 500 Meter weiter am Dorf vorbei geleitet wird. Wir müssen darauf drängen, dass die Politik es schafft, dass weniger Verkehr stattfindet. Umgehung ist mit Sicherheit keine langfristige Lösung“, ist die einhellige Meinung der Naturschützer.
14.12.2016 - BN zum Bebauungsplan Fachmarktzentrum Aischparkcenter
23.05.2016 - Josef Göppel, MdB, CSU zum Offenen Brief EEG-Novelle
18.05.2016 - Offener Brief an Mittelfrankens MdBs zur EEG-Novelle
20.03.2016 - Leitlinien der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach für 2016
25.02.2016 - BN unterstützt Windpark Wachenroth
20.02.2016 - Amphibien so früh wie noch nie auf Wanderschaft
04.02.2016 - BN erarbeitet Konzept für Ruheplatz "Am Graben"
26.01.2016 - Kompromiss mit Stadt Höchstadt - Keine Tulpenbäume
21.01.2016 - Geplante Höchstadter Baumfällung "Am Graben"
14.12.2016 - BN zum Bebauungsplan Fachmarktzentrum Aischparkcenter
Der Bebauungsplan zum geplanten Fachmarktzentrum Aischparkcenter in Höchstadt enthält aus Naturschutzsicht wesentliche Mängel, die in der Stellungnahme des BN an die Stadt Höchstadt detailliert dargelegt werden.
1. Fortschreibung des Landschaftsplans fehlt
Naturschutzrechtliche Maßnahmen sind aus der Fortschreibung des Landschaftsplanes zu entwickeln. Er stellt Bereiche dar, die für einen Ausgleich besonders geeignet sind. Nur so können Ausgleichsmaßnahmen in ein Gesamtkonzept zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft einbezogen werden. Leider hat die Stadt Höchstadt seit einer bereits mehrjährigen Ankündigung bis heute noch keinen gültigen, aktuellen Landschaftsplan. Somit sind lokale Aussagen nur unzureichend möglich.
2. Fragwürdige Wahl der Ausgleichsflächen
Wie schon bei der Problematik des Ausgleichs in der Aischaue müssen wir auch hier wieder darauf hinweisen, dass es nicht ganz nachvollziehbar ist, dass der Ausgleich in 10 km Entfernung vollzogen werden muss (Buchfeld). Dies deutet darauf hin, dass die Auswahl eher auf einer günstigen Grundstücksbeschaffung basieren könnte, als auf einer gezielten fachlichen Auswahl. Für die Artenschutzmaßnahmen nahe Etzelskirchen müssen auch entsprechende Verträge mit den Landwirten vorliegen, die detailliert auf die Position der Lerchenfenster als auch auf die Bewirtschaftung und Fruchtfolge eingehen. Ist dies nicht geregelt, ist die Ausweisung reine Makulatur.
3. Fehlende CEF-Maßnahmen
Auch sind wir absolut der Meinung, dass durch die Bebauung des Aischparkcenters der Lebensraum der Feldlerche zerstört wird, und damit ein Verlust des Reviers unwiederbringlich einhergeht. Daher ist es unverständlich, dass keine CEF-Maßnahmen (Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion) nötig sein sollen, obwohl durch die Untersuchungen des Planers eindeutig drei Brutpaare festgestellt wurden. Erst durch diese Maßnahme kann sicherstellt werden, dass die lokale Population nicht erheblich beeinträchtigt wird, da auch die Lebensraumfunktionen unter Berücksichtigung der CEF-Maßnahmen insgesamt gewahrt bleiben. CEF-Maßnahmen müssen aber vor Baubeginn abgeschlossen sein.
4. Fehlerhafte Bewertung besonders geschützter Arten
Die Feldlerche ist zwar ein verbreiteter, jedoch vielerorts in starker Abnahme begriffener, gefährdeter Brutvogel der Agrarlandschaft. Als Bodenbrüter mit einer ausgeprägten Bindung an landwirtschaftlich genutzte Lebensräume (Äcker, Wiesen) führt die Intensivierung der Landnutzung sowie die Überbauung landwirtschaftlicher Flächen zu einer hohen Bestandsabnahmen (kurzfristig größer 50%). Daher ist sie auch auf der Liste der besonders geschützten Arten nach Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt. Der § 44 Abs. 1 (1) BNatSchG verbietet es, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Aus diesem Grund ist eine CEF-Maßnahme, die vor Baubeginn beendet sein muss, für die Erfüllung des §44 unumgänglich.
5. Zu geringer Ausgleich
In der Ermittlung der Ausgleichsflächen wird der Lebensraum der Feldlerche, aber auch der Zauneidechse nicht berücksichtigt. Es heißt dort lediglich "Unter Berücksichtigung der hohen Nährstoffbelastungen und des hohen Nutzungsdruckes werden die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen mit 0,5 ausgeglichen, ebenso wie die ebenfalls intensiv genutzten Pferdekoppeln sowie wegbegleitende Gras-/Krautsäume." Aufgrund der vorhandenen schützenswerten Arten, die offenbar nicht einbezogen wurden, ist dieser Wert zu niedrig angesetzt, wodurch in Folge die Ausgleichsflächen erhöht werden müssen.
6. Betonwüste vermeidbar
Da der Parkplatz keinerlei Grünflächen aufweist, muss eine Dachbegrünung für sämtliche Gebäude zwingend realisiert werden. Leider zeigt unsere Erfahrung, dass Aussagen in der Planungsphase später revidiert werden, wobei gerade aus dem Lebensmittelbereich fadenscheinige Argumente dagegen vorgebracht werden. Damit der Parkplatzbereich nicht einer Betonwüste gleichkommt, sollte zumindest im Mittelteil ein möglichst breiter Grünstreifen zusätzlich angelegt werden. Dazu kann man auf eine Reihe Parkplätze verzichten. Ein Verlust von ca. 50 Plätzen, der bei der Menge von insgesamt 726 Stellplätzen locker zu verkraften ist, verbessert nicht nur das Kleinklima, sondern macht auch einen optisch einladenderen Eindruck. Das sind dann immer noch mehr Parkplätze als die Metro in Nürnberg ausgewiesen hat.
7. Auf Erneuerbare Energien setzen
Um dem Klimawandel zu begegnen und den Energiebedarf zu reduzieren, ist es dringend angebracht, auf erneuerbare Energien zu setzen. Es widerspricht keinesfalls, den extensiv begrünten Flach- bzw. Pultdächern noch Solarpaneele darauf zu setzen. Weder die Begrünung, noch die Paneele werden dadurch beeinflusst. Langfristig wird der Strombezug jedenfalls günstiger.
Helmut König
1. Kreisvorsitzender
23.05.2016 - Josef Göppel, MdB, CSU zum Offenen Brief EEG-Novelle
Antwort des Bundestagsabgeordneten Josef Göppel, CSU auf den Offenen Brief zur EEG-Novelle 2016.
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihren Brief. Sie haben meine volle Unterstützung!
Mit der Einführung von Ausschreibungen im EEG wird sich die Situation für die Anlagen in Bürgerhand völlig neu darstellen. Die Stromerzeugung wird nicht einfacher, sondern bürokratischer, sie wird auch nicht billiger, sondern teurer. Die breite Beteiligung an der Energieerzeugung ist in ernster Gefahr. Die Ergebnisse der Pilotausschreibungen für die Photovoltaik belegen dies.
Selbst die EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager schreibt in einem Brief vom 12. Februar 2015 an deutsche Bundestagsabgeordnete: "Kleinere Projekte, die eine gewichtige Rolle beim Umbau der Energieversorgung spielen, befinden sich in einer besonderen Lage. Ausschreibungen sind möglicherweise nicht das richtige Instrument für kleine Projektträger." Auch aus Sicht der EU-Kommission besteht also bei der Einführung von Ausschreibungen die Gefahr der Verdrängung kleiner und mittlerer Akteure. Gerade diese lokal verankerten Unternehmen sind für die Akzeptanz der Energiewende unabdingbar.
Ebenso bedeutsam sind Bürgerbeteiligungen auch, um die Finanzierung der Energiewende sicherzustellen. In den europäischen Nachbarländern ist – anders als in Deutschland – kein vergleichbar ideenreicher und lebendiger Mittelstand im Energiebereich entstanden. Kleinere und mittlere Akteure, wie mittelständische Projektierer und Bürgerenergiegesellschaften, können bei Ausschreibungen das Risiko eines Nichtzuschlags nicht streuen.
Ausschreibungen: Kompromissvorschlag des Bundesrats
Fehler im Ausschreibungsdesign können irreparable Schaden anrichten. Der Bundesrat hat deshalb am 22. April beschlossen: „Der Bundesrat schlägt vielmehr ein Modell vor, nach dem die der Definition entsprechenden Bieterinnen bzw. Bieter sich ohne Angabe eines Gebotspreises an den jeweiligen Ausschreibungsrunden beteiligen können und die Garantie eines Zuschlags erhalten. Der jeweilige Gebotspreis und damit die Förderhöhe bestimmen sich dann nach dem höchsten Gebot, das neben ihnen noch einen Zuschlag erhalten hat. [… Der Bundesrat] bittet aber die Bundesregierung, den räumlichen Bezugspunkt der „lokalen Verankerung“ von Bürgerenergieprojekten dahingehend zu überprüfen, ob statt einer Anknüpfung an einen Landkreis besser eine Anknüpfung an einen (bestimmten, auch landkreisübergreifenden) Umkreis erfolgen sollte. Ferner bittet der Bundesrat die Bundesregierung, zu prüfen, inwiefern insbesondere Kommunen stärker berücksichtigt werden können."
Ich halte diese Position bei der Windkraft für einen akzeptablen Kompromiss, falls sich eine vollständige Ausnahme unterhalb der von der Europäischen Kommission vorgegebenen Freigrenze von 6 Windkraftanlagen nicht durchsetzen lässt. Für Photovoltaikanlagen unterstütze ich den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums, die EU-Freigrenze von einem Megawatt voll auszuschöpfen.
Für Biogasanlagen muss rasch eine Anschlussregelung für den Weiterbetrieb von Anlagen nach dem Auslaufen der EEG-Förderung gefunden werden. Biogasanlagenbetreiber wollen ihre Anlagen systemdienlich betreiben und umrüsten. Das ist mit zusätzlichen Investitionen verbunden. Ohne klare Rahmenbedingungen nach dem Auslaufen der EEG-Förderung fehlt die Investitionssicherheit. Deshalb sollten neben neuen auch bestehende Biogasanlagen an Ausschreibungen teilnehmen können, wenn sie auf eine flexible Fahrweise umrüsten. Für Kleinstanlagen und Bioabfallanlagen sollen die Bedingungen des EEG 2014 weitergelten. Die Einbeziehung von Bestandsanlagen bietet die Chance, die EEG-Kosten zu senken und gleichzeitig Biogasanlagen gezielt als systemdienliches Element der Energiewende zu stärken. Biogasanlagen müssen künftig neben Ausgleichsenergie auch Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung oder Schwarzstartfähigkeit bereitstellen.
Ausbauvolumen
Analysen zeigen, dass das Bundeswirtschaftsministerium mit dem im EEG-Entwurf vorgeschlagenen Ausbaupfad in den nächsten Jahren unterhalb des eigentlich notwendigen Ausbaus bleibt, wenn das Ziel einer weitgehenden Stromversorgung aus erneuerbaren Energien bis 2050 erreicht werden soll. Ich setze mich deshalb vehement dafür ein, den Ausbau nicht zu bremsen. Ihr Vorschlag eines Brutto-Ausbaus von 4 400 MW Windkraft an Land passt dazu.
Herkunftsnachweis
Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich mit dem Vorschlag einer regionalen Herkunftskennzeichnung in die richtige Richtung bewegt. Bisher ist der Strom aus einer Anlage, die nach dem EEG gefördert wird, anonymer Graustrom. Künftig soll es möglich werden, dass in der Stromrechnung gekennzeichnet werden kann, wenn der Strom aus einer Anlage im 50 km – Umkreis kommt. Für die Akzeptanz von erneuerbaren Kraftwerken ist das ein wichtiger Schritt: Der Kunde kann sich entscheiden, dass sein Strom aus einem regionalen Windrad, einer Photovoltaikanlage oder einer Biogasanlage kommen soll. Viele Akteure hätten sich mehr gewünscht. Dennoch ist das einfache Modell des Bundeswirtschaftsministeriums, das sich am Vorschlag des Verbands kommunaler Unternehmen orientiert, unterstützenswert.
Aus europarechtlichen Gründen schlägt das Bundeswirtschaftsministerium jedoch vor, dass den-noch für die gesamte an den Endkunden gelieferte Strommenge Grünstromzertifikate gekauft werden müssen. Angeblich würden Grünstromimporte aus anderen EU-Ländern diskriminiert, wenn der regionale Grünstromanteil nicht zusätzlich mit Zertifikaten hinterlegt würde. Ich kann das nicht nachvollziehen. Unverständlich ist, dass die regionalen Stromlieferanten einen Abzug in Höhe des Zertifikatspreises von der Marktprämie hinnehmen müssen. So wird für die Grünstromeigenschaft doppelt bezahlt. Das muss im parlamentarischen Verfahren nachgebessert werden.
Mieterstrom
Mieter können aus dem Eigenverbrauch von Sonnenstrom nicht die gleichen Vorteile ziehen wie Hauseigentümer. Ich setze mich hier für eine Gleichstellung ein.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Josef Göppel, MdB
18.05.2016 - Offener Brief an Mfrankens MdBs zur EEG-Novelle
Die Kreisgruppe hat gemeinsam mit einer großen Gruppe klima-, umwelt- und energiebewußter Vereine, Verbände und Energiegenossenschaften (36) aus Mittelfranken einen offenen Brief an alle mittelfränkischen Bundestagsabgeordneten zur bevorstehenden Abstimmung zur EEG-Novelle am 18.05.2016 versendet.
Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages aus Mittelfranken,
die Abstimmung zur EEG-Novelle steht bevor und wir befürchten, dass die aktuelle Gesetzesvorlage zu einem massiven Ausbremsen der erneuerbaren Energien und damit der Energiewende führt. In Paris hat die Staatengemeinschaft Ende 2015 in der UN-Klimakonferenz beschlossenen, den weltweiten Temperaturanstieg aufmöglichst 1,5°C zu begrenzen, um die Folgen des Klimawandels, die wir schon heute spüren, abzumildern. Elementarer Eckpfeiler dazu ist der Ausbau der CO 2 -freien erneuerbaren Energien. Die Bundesrepublik bekennt sich zu diesen Zielen. Die letzten EEG-Novellierungen haben aber den Zubau von Photovoltaikanlagen bereits unter den von der Bundesregierung gesetzten Ausbaukorridor gedrückt und die Errichtung flexibler Biogasanlagen abgewürgt. Darüberhinaus wurden die Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements durch kostenintensive und risikoreiche Ausschreibungsverfahren maßgeblich beschnitten. Mit der bevorstehenden Novelle wird dieselbe negative Entwicklung bei der Windenergie an Land vollzogen.
Windkraft ist der stärkste Motor der erneuerbaren Stromerzeugung. Sie produziert schon heute den größten Anteil des sauberen Stromes in Deutschland. Bei uns in Bayern betrug die Nennleistung aller Windanlagen 1.892 MW im Jahr 2015. Bei stabiler Entwicklung könnten Windkraftanlagen an Land und auf See bis 2030 25% bis 30% des gesamten inDeutschland benötigten Stromes decken. Doch das EEG 2016 bremst das Wachstum und deckelt den gesamten EE-Anteil am deutschen Strommix willkürlich auf 45% bis 2025. Dabei verlangt das Klimaschutzabkommen von Paris einedeutlich ambitioniertere Zielmarke von 60%.
Begrundet wird das Abbremsen der Energiewende mit dem zögerlichen Netzausbau, der produzierte EE-Strom könnenicht verteilt werden. In Süddeutschland müssen aber keine EE-Anlagen in nennenswertem Umfang abgeschaltet werden, da die Stromnetze noch aufnahmefähig sind. Gerade der dezentrale Erzeugungsausbau verhindert Netzengpässe, wie die VDE-Studie "Der Zelluläre Ansatz" aus 2015 beeindruckend belegt. Natürlich muss parallel die klimaschädliche Kohleverstromung reduziert werden, die bei hoher EE-Stromerzeugung nicht abgeregelt werden kann und die Netze verstopft.
Deutschlands Rolle als Klimaschutzvorreiter und technologischer Weltmarktführer steht genauso auf dem Spiel wieviele der weit über 300.000 Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien in der Bundesrepublik. Auch inMittelfranken haben wir viele innovative mittelständische Betriebe und Industriekonzerne, die direkt vom nationalenund internationalen EE-Ausbau und der erforderlichen globalen Dekarbonisierung der Wirtschaft profitieren. Die Bundesregierung muss sich mit dem EEG 2016 zum konsequenten Umbau bekennen und darf nicht rückwärtsgewandtauf die veraltete und klimaschädliche fossile Industrie setzen, die zudem erhebliche Unendlichkeitslasten erzeugt. Moderne Technologien im Bereich der Energiespeicherung, der Energieeinsparung und der Energieeffizienz müssen konsequent gefördert und mit Markteinfuhrungsprogrammen begleitet werden.
Wir fordern daher dringend, die EEG-Novelle 2016 nicht in der geplanten Form zu verabschieden, sondern in wichtigen Punkten zu überarbeiten:
Erstens: Aufhebung der Deckelung des Anteils erneuerbarer Energien von 45% bis 2025 und Wahrung der Ausbauzieleder Länder sowie der nationalen Klimaschutzziele. Dafür sind geeignete Rahmenbedingungen mit regional angepasstenEinspeisevergütungen und Strommarktregelungen zu schaffen: Höhere Vergütungen in Süddeutschland, wo keine Netzengpässe bestehen und die Verbrauchszentren liegen. Der Einspeisevorrang der erneuerbaren Energien darf nicht weiter beschnitten werden, die Kohleverstromung muss zurückgefahren werden.
Zweitens: Ein dynamisches Ausbauvolumen von 4.400 MW brutto für Wind an Land, was dem Erhalt des 2014 zwischen Bund und Ländern vereinbarten realen Zubaus von 2.500 MW netto entspricht. Der jetzige Entwurf für das EEG 2016 sieht eine Anrechnung des Repowering (Bestandssanierung) vor. Da dessen Anteil deutlich steigen wird, bleibt kaum noch Raum für zusätzliche Windkraftanlagen. Es ist zu befürchten, dass der reale Windleistungszubau auf ein Minimum schrumpft oder sogar den Nullpunkt erreichen wird.
Drittens: Verbesserung der Regelungen, die das bürgerschaftliche Engagement für die Erneuerbaren erhalten. Dies betrifft vor allem die Abschaffung der Ausschreibung im Bereich Photovoltaik und den Verzicht auf Ausschreibungen bei Onshore-Windanlagen. Vorlage dazu sind die von der EU zugelassenen Leistungsgrenzen für kleine Bürgeranlagen (Deminimis-Regelung, bis zu 6 Windräder oder bis zu 18 MW Leistung). Ziel muss die Energiewende mit bürgerschaftlicher Beteiligung und dezentraler Erzeugung sein.
Den Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere der preisgünstigen Windkraft an Land, gerade jetzt einzuschränken, darf nicht das Ziel der deutschen Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik sein. Wir appellieren an Ihre Verantwortung, diesen vitalen Zweig der deutschen Industrie mit ihren zukunftssicheren Arbeitsplätzen zu schützen und bei der Einhaltung der Klimaschutzziele auf Kurs zu bleiben.
Wir freuen uns von Ihnen zu erfahren, welche Änderungen der EEG-Novelle Sie unterstützen werden. Bitte senden Sie Ihre Antwort per Email an die Unterzeichner.
Mit freundlichen Grüßen
Die Unterzeichner
20.03.2016 - Leitlinien der BN-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach für 2016
Bei der zweitägigen Klausur der Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des Bund Naturschutz (BN) in Vestenbergsgreuth (19.-20. März 2016) legte der BN-Vorstand die Leitlinien für die kommenden 12 Monate fest.
Unter Leitung von Helmut König, 1. Vorsitzender der Kreisgruppe und Tom Konopka, BN-Regionalreferent für Mittel- und Oberfranken wählte das Vorstandsteam unter anderem folgende Themen: Wasserqualität, Flächenverbrauch in den Gemeinden des Landkreises durch Wohn- und Gewerbegebiete, geplante Südumfahrung Herzogenaurach und die Zusammenarbeit mit den Teichwirten in Verbindung mit dem Naturschutzprojekt „Karpfen pur Natur“. Zudem soll das ausstehende Alternativkonzept der STUB-Gegner eingefordert werden.
20.02.2016 - Amphibien so früh wie noch nie auf Wanderschaft
Noch nie zuvor waren sie so früh unterwegs: Die wärmeren Tage derzeit locken Kröten, Frösche und Molche aus den Winterquartieren. Erste „Wanderer“ wurden sogar schon Ende Januar gesichtet. Ursache dafür ist der durchwegs sehr milde Winter. Überall in Bayern werden deshalb zurzeit Amphibienzäune aufgebaut. Rund 6000 freiwillige Helfer des BUND Naturschutz (BN) sind dabei im Einsatz und bringen die Tiere sicher über die Straßen. Es ist die größte Mitmachaktion des Naturschutzes in Bayern. Sie rettet jährlich rund 700 000 Amphibien das Leben.
04.02.2016 - BN erarbeitet Konzept für Ruheplatz "Am Graben"
Am Dienstag, 02.02.2016 fand ein außerordentliches Treffen der Bund Naturschutz (BN) Ortsgruppe Höchstadt im ASV-Sportheim statt. Thema war die Neugestaltung des Platzes „Am Graben“. Neben einer erfreulichen Anzahl interessierter Höchstadter waren auch Christoph Reuß, BN-Ortssprecher, Helmut König, 1. Kreisvorsitzender und Dr. Krautblatter zugegen.
Letzterer hatte einen Vorschlag zur Neugestaltung ausgearbeitet, der in der Runde diskutiert wurde. Zu allererst mussten aber einigen Teilnehmern die ästhetischen, botanischen wie praktischen Gründe vermittelt werden, warum nicht die bestehenden Kastanien erhalten bleiben sollen. Der BN kommt damit der Stadt entgegen, die spätere Pflege nicht zu verkomplizieren.
Konsens in der Runde war, dass der Platz viel Grün aufweisen muss. Der Platz muss vor allem Ruhebereich und Entspannungszone in der sonst städtischen Umgebung sein. Wesentliches Merkmal dabei ist eine optimale Beschattung für die heißen Tage unserer immer wärmer werdenden Sommer. Eine Abschirmung zum weiterhin vorhandenen Verkehr auf der Hauptstraße, eine maximal mögliche Ruhezone, als auch Kinder vor dem Straßenverkehr zu schützen, war den BN-Mitgliedern wichtig.
Als Baum wie auch als Hecke wurde die Hainbuche ausgewählt (Carpinus petulus, Sorte Columnaris). Sie ist eine robuste einheimische Baumart, die Wärme gut verträgt und trotzdem frosthart ist. Sie verträgt im Vergleich zur Kastanie den Rückschnitt gut, was sich auch in den sehr beliebten, dichten und über die Jahreszeit lang bleibenden grünen Hecken widerspiegelt. Sie ist die bewährte Schnittheckenpflanze schlechthin. Von Vögel wird sie gerne zur Brutzeit aufgesucht. Die Hainbuche ist ein langsam wachsender Baum, sodass er für viele Jahre keinen Rückschnitt benötigt. Die gewählte Sorte erreicht Höhen bis zu 10 Meter mit einem maximalen Kronendurchmesser von ca. 7 Metern.
Der Vorschlag im Detail:
Eine ein Meter breite Hainbuchenhecke umschließt den Platz, in dessen Mitte sich der Springbrunnen befindet. Der Zugang erfolgt nicht von der Hauptstraße bzw. dem Parkplatz „Am Graben“, sondern seitlich über den etwas verbreiteten 1,5 Meter breiten Gehweg oder dem ca. 3 Meter breiten Fußweg, welche die Hauptstraße mit dem Parkplatz verbinden. Die Hecke wird auf 1,5 Meter Höhe geschnitten, sodass der Platz von außen einsehbar ist, trotzdem aber ein Schutz für dort Sitzende gewährleistet wird.
Die Hainbuchen mit ihren ca. 7 Meter Kronendurchmessern sind so platziert, dass sie die umliegenden Gebäude nicht tangieren. Zwischen den Bäumen werden Bänke und Blumenkübel oder Blumenrabatten positioniert.
Ein mögliches Szenario:
Auf der Hauptstraße fahren weiterhin Autos. Ältere Leute und gestresste Jüngere suchen etwas Abkühlung an einem heißen Sommertag. Sie lassen sich unter den schattigen Hainbuchen auf einer Bank nieder, im Rücken den Sicht- und Windschutz der Hecke, vor sich das plätschernde Wasser. Mütter, aber auch immer mehr Väter, kommen mit ihren Kindern, die sich ebenfalls am kühlen Nass erfreuen, und sicherheitshalber nicht sofort auf die Hauptstraße laufen können. Dies trägt wesentlich zur Entspannung bei. Kein Durchgangsverkehr stört. Ein stadtbekannter Platz, um dem heißen und flimmernden Hauptplatz zu entrinnen.
Allen war jedenfalls klar, sie wollen keinen Platz mit rein „städtischem Charakter“.
Dr. Hans Krautblatter, Biologe
Christoph Reuß, BN Höchstadt, Ortssprecher
Helmut König, Bund Naturschutz, 1. Vorsitzender
26.01.2016 - Kompromiss mit Stadt Höchstadt - Keine Tulpenbäume
Am Dienstag, den 26.01.2016 trafen sich die, für die Neugestaltung des Platzes verantwortlichen Planer der Stadt Höchstadt mit Vertretern des Bund Naturschutz (BN). In einem sehr konstruktiven Gespräch kam man zu folgenden Ergebnissen:
Die vier Kastanien decken zum jetzigen Zeitpunkt mit ihren Kronen den Platz recht gut ab, spenden also den erwünschten Schatten, weisen aber ein starkes Wachstum auf, sodass sehr bald starke Rückschnitte nötig wären. Das ist bei der größten Kastanie schon seit einiger Zeit der Fall. Solche Rückschnitte sind alles andere als schön, sie werden von den Bäumen zudem sehr schlecht vertragen.Für eine weit in die Zukunft reichende gute Lösung müsse man schweren Herzens nach würdigen Nachfolgern für die Kastanien suchen.
Die ursprünglich vorgeschlagenen Tulpenbäume waren nach kurzer Diskussion als völlig ungeeignete Exoten vom Tisch. Als ideale Nachfolger einigte man sich auf großkronige Hainbuchen (Weißbuchen) mit kontrolliertem Wuchs. Bürgermeister Brehm versicherte, dass man sich die Größe durchaus einiges kosten lasse.
Um die vier Bäume soll möglichst viel Grün angesiedelt werden. Dabei denkt man vor allem an Heckensträucher. Große Blumentröge mit jahreszeitlich wechselndem Blumenflor sollen zwischen die Sitzbänke, die im Kreis in gebührendem Abstand um den Springbrunnen gruppiert sind. Dort sprudelt aus ebenerdigen Steinplatten in mehreren Fontänen das Wasser.
So könnte der Platz zu einem Ort werden, wo man sich wohl fühlt: Auf der Bank sitzend, vor sich das munter plätschernde Wasser, neben sich der Blumenflor, im Rücken abgeschirmt durch Heckensträucher, im (sommerlichen) Schatten einer Hainbuche.
Der BN legte in der Runde vor allem großen Wert auf folgende Punkte:
- Es müssen vor allem große Exemplare der Hainbuche sein, die bereits nach ihrer Pflanzung dank ihrer umfangreichen Kronen eine starke Beschattung ermöglichen.
- Durch große, gut vorbereitete Pflanzgruben sollen lebenswichtige Standortfaktoren sichergestellt werden.
- Ein Exote wie der Tulpenbaum, mit einer Reihe problematischer Eigenschaften, scheidet bei der Wahl eines Nachfolgers von vornherein aus. Mit der Wahl der Hainbuche wird einen Baum favorisiert, der im Eichen-Hainbuchenwald als Charakterart auf tonigen Böden (Letten) zu unserer fränkischen Heimat gehört.
- Da es sich um eine „Begrünung“ des Platzes handeln soll, sind Sträucher und Blütenpflanzen eine Selbstverständlichkeit.
- Für die Stadt selbst ist damit ein wichtiges Bindeglied des Grüngürtels vom Engelgarten über die Altstadt und den Kellerberg bis zum Weingartsgraben geschaffen.
Dr. Hans Krautblatter, Biologe
Christoph Reuß, BN Höchstadt, Ortssprecher
Helmut König, Bund Naturschutz, 1. Vorsitzender
21.01.2016 - Geplante Höchstadter Baumfällung "Am Graben"
Im Interesse einer attraktiven, gut strukturierten Stadt versucht man in Höchstadt seit Jahren den Grüngürtel vom Engelgarten über den Kellerberg bis zum Weingartsgraben zu vervollständigen, bzw. in gutem Zustand zu erhalten. Das ist auch ein wesentliches Anliegen von Kellerberg- und Heimatverein. Die Neugestaltung „Am Graben“ lieferte vor Jahren einen wertvollen Beitrag, um eine Lücke in der vergleichsweise baumarmen Altstadt zu schließen. Die vier Platanen, die den Parkplatz strukturieren und die vier Kastanien, die sich in respektablen Abstand um den Springbrunnen gruppieren, sind in der Zwischenzeit zu haushohen Bäumen mit mächtigen Kronen herangewachsen, die die Funktion einer „grünen Lunge“ in der Stadt bestens erfüllen können. Denkt man an den zurückliegenden Sommer, dann ist ein weiterer Effekt nicht hoch genug einzuschätzen, der wohltuende, kühle Schatten, den diese Bäume spenden.
Doch da platzt eine Schreckensnachricht herein: Die vier großen Kastanien sind in das neue Platzkonzept mit Wasserelement nicht zu integrieren, bis März sollen sie gefällt sein. (NN, 15.1.2016)
Das wäre eine neue, verhängnisvolle Dimension. Anstatt, wie bisher vor allem am Kellerberg, eine behutsame Pflege des Altbestandes zu betreiben mit der Entnahme dürrer Äste oder absterbender Bäume, würden nun vitale, leistungsstarke Bäume eliminiert.
Da drängt sich geradezu die Frage auf, ob ein talentierter, zukunftsbewusster Planer nicht in der Lage ist, in der weitläufigen Anlage das wertvolle Kapital der vier großen Kastanienbäume geschickt zu integrieren, anstatt einen Kahlschlag zu fordern. Von Seiten des Bauingenieurs ist es durchaus möglich, die Kastanien stehen zu lassen, von der technischen Seite spricht nichts dagegen (FT, 20.1.2016).
Nach den Vorstellungen des Landschaftsarchitekten „soll ein offener Platz mit veränderter Höhenlage und städtischem Charakter“ entstehen, bei dem „die Kastanien nicht mehr in das Gesamtbild passen, zumal sie noch größer werden“ (FT). Als ob wir in Mitteleuropa nicht hervorragende Schattenspender hätten, hat man sich für die Ersatzpflanzung eine phantasievolle Variante ausgedacht, den Tulpenbaum:
Der Tulpenbaum ist ein schnell wachsender Riese, der in seiner Heimat, der östlichen USA bis 60m hoch wird, und am ehesten für große Parks geeignet ist.
Dem gegenüber ist die Kastanie seit Jahrhunderten ein beliebter Zierbaum in Alleen und auf Plätzen und gerade in grünen Musterstädten gut vertreten.
Die für die Pflanzung vorgesehene Zuchtform des Tulpenbaumes (Liriodendron tulipifera) gilt als besonders schlank und säulenförmig. Dadurch wird sie der Vorstellung des Architekten von einem „offenen Platz“ entgegenkommen, dem Wunsch der Bürger nach wohltuendem, kühlen Schatten an heißen Sommertagen aber diametral entgegenstehen - man denke an den letzten Sommer! So wird der Wunsch des Planers, der Platz möge „ein Aufenthaltsbereich für den Bürger“ werden, eine Illusion bleiben. Selbst die erforderlichen Zusatzkosten für eine Neubepflanzung dürften nicht unerheblich sein.
Einer solchen Variante vier prächtige, vitale Kastanien zu opfern wäre absolut unverantwortlich.
Dr. Hans Krautblatter, Biologe
Christoph Reuß, Ortssprecher Höchstadt
Helmut König, 1. Vorsitzender
18.12.2015 - Artenschutzrechtliche Prüfung von der Stadt Herzogenaurach gefordert
15.12.2015 - Windkraftanlage Wachenroth
17.11.2015 - Raumordnungsverfahren Niederndorf-Neuses
02.09.2015 - BN erstattet Anzeige wegen Störung im Naturschutzgebiet Mohrhof
19.08.2015 - Deponie Lonnerstadt
21.07.2015 - Fehlendes Energiekonzept im Baugebiet Reuthsee, Adelsdorf
22.05.2015 - Einhaltung der Gesetze eingefordert
21.04.2015 - Anhörung A3 - BN fordert Grünbrücke
09.04.2015 - Aufruf zur naturnahen Teichbewirtschaftung
18.12.2015 Artenschutzrechtliche Prüfung von der Stadt Herzogenaurach gefordert
Aufgund mangelhafter faunistischer Untersuchung des geplanten Baugebietes „Niederndorf Süd - Am Behälterberg“ durch die Stadt Höchstadt fordert der BN eine Spezielle artenschutzrechliche Prüfung. (SaP)
In der Begründung des Bebauungsplans Nr. 64 wird beschrieben, dass keine Kenntnisse über besondere Vorkommen seltener oder gefährdeter Arten vorliegen. Uns liegen jedoch Aussagen von Anliegern vor, die uns glaubhaft vermittelt haben, daß sich in einer Trockenmauer zur Hangabsicherung zum angrenzenden Acker, über die Jahre ein kleines Biotop im Feldrain gebildet hat.
Es hat den Anschein, dass die Untersuchungen, die im Zuge der geplanten Ortsumfahrung 2013 durchgeführt wurden, nur sehr oberflächlich stattfanden. Dies läßt sich auch aus der Aussage „Vorkommen sind aufgrund der anthropogen stark beeinflussten Standortverhältnisse nicht zu erwarten.“, wie sie in der Begründung zum Bebauungsplan zu finden ist, ableiten.
Da bei dem Eingriff offensichtlich nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass möglicherweise streng geschützte Tiere betroffen sind, fordert der BN eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen.
Sollten entsprechende Tierarten gefunden werden, bitten wir bestandserhaltende Maßnahmen (z.B. Umsiedelung) einzuleiten.
Helmut König
1.Vorsitzender
15.12.2015 - Windkraftanlage in Wachenroth
Der BN nimmt Stellung zur 9. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans sowie zur Aufstellung des Bebauungsplans „Bürgerwindpark Wachenroth“ zur Nutzung regenerativer Windenergie in der Gemarkung Weingartsgreuth.
Der BN erhebt keine Einwendungen gegen das Vorhaben.
Wir befürworten die Konzentration von Windkraftanlagen auf dafür ausgewiesenen Flächen im regionalplanerischen Vorranggebiet Windkraft WK36, da auch dies zu einer Risikoreduzierung von Kollisionsgefahren mit Vögeln oder Fledermäusen beiträgt. Zusätzlich ist das Gebiet durch die naheliegende Bundesautobahn A3 bereits entsprechend vorbelastet.
Aufgrund des Standortes und den benannten Auflagen aus Betriebseinschränkungen bzw. Abschaltungen durch das begleitende Monitoring in sensiblen Zeiten wird eine Minimierung der Beeinträchtigung gefährdeter Arten angestrebt und sicher auch erreicht. Die Abschichtungstabellen, als Basis der Speziellen artenschutzrechlichen Prüfung (saP), sind korrekt und umfangreich. Den Bewertungen und Aussagen der saP wird zugestimmt. Das Schallgutachten wiederlegt wieder einmal die 10H-Regelung. Der Lärmschutz wird bereits in 750m Entfernung eingehalten. Das Schattenwurfgutachten zeigt unter realistischen Bedingungen keine Überschreitung von den festgelegten Grenzwerten.
Eine konsequente Überprüfung der CEF-Maßnahmen wird vorausgesetzt und von behördlicher Seite auch erwartet.
Helmut König
1. Vorsitzender
17.11.2015 - RAUMORDNUNGSVERFAHREN NIEDERNDORF-NEUSES
Der BN hat zum Raumordnungsverfahren (ROV) "Geplante Ortsumgehung Niederndorf-Neuses" eine 10-seitige Stellungnahme abgegeben. Hier stellen wir eine verkürzte, die wesentlichen Aussagen aber enthaltende Version zur Verfügung.
Der BN lehnt die Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses ab, weil der Bedarf nicht nachgewiesen werden kann, zumindest die prognostizierten Verkehrssteigerungen auf nicht belastbaren Daten basieren. Der Bau würde zu massiven Eingriffen in Natur und Umwelt führen. Weder wurde die geplante Stadt-Umland-Bahn (StUB) berücksichtigt noch die sich aufdrängenden Alternativen und Varianten geprüft. Weil der Bau der Straße zu einer Kannibalisierung der umweltfreundlichen Stadt-Umlandbahn führen würde, ist es auch aus finanziellen Gründen abzulehnen.
Zu den Details:
1. Verfahrensfehler
Nach dem Bayerisches Landesplanungsgesetz müssen Ort und Zeit der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht werden. Dies ist hier nicht korrekt geschehen. Die Auslegungsfrist wurde verkürzt, und die Abgabefrist unzureichend definiert.
2. Mängel der Verkehrsprognose: Die prognostizierten Verkehrssteigerungen basieren auf nicht belastbaren Daten
Die Daten, welche den Bedarf der Umfahrung belegen sollen, werden vom BN angezweifelt.
2.1 Aktuelle Entwicklung bei Schaeffler
Die Verkehrsprognose basiert auf nicht aktuellen Daten. So wird angegeben, dass vor allem durch die Fa. Schaeffler ein Mitarbeiterzuwachs von 18% bis 2025 prognostiziert wird, womit dann sogar die Gesamtsteigerung des Verkehrs von 20% begründet wird. Durch die geplante Umstrukturierung der Schaeffler-Werke ist jedoch von einer mindestens zehnprozentigen Reduzierung der MitarbeiterInnen inklusive der ZeitarbeiterInnen auszugehen. Dies steht im Widerspruch zur Prognose.
Zusätzlich sollte man einer großen Firma auch erklären können, dass es für die Stadtentwicklung günstiger wäre, Erweiterungen im Norden an der vorhandenen Umgehungsstraße zu planen.
2.2 Widersprüche mit der verkehrlichen Zielsetzung
Die Stadt Herzogenaurach hat 2014 den Titel „Fahrradfreundliche Kommune“ vom Bayerischen Verkehrsminister verliehen bekommen. Voraussetzung für diese Auszeichnung ist die klare verkehrspolitische Zielsetzung den Fahrradverkehrsanteil bis zum Jahr 2020 auf 25 Prozent zu erhöhen. "Zwischen den Stadtqaurtieren beträgt der Verkehr über 50 Prozent des Verkehrsaufkommens, mit Fahrten oft nur bis 3 km. Das motorisierte Verkehrsaufkommen könnte, wenn diese kurzen Wege mit dem Stadtbus oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden und das Auto nicht unbedingt gebraucht wird, deutlich gesenkt werden.“
Die Ergebnisse der Verkehrsprognose stehen hierzu im klaren Widerspruch. Offensichtlich wurden die verkehrspolitischen Zielsetzungen nicht hinreichend berücksichtigt.
2.3 Radschnellwege
Derzeit werden in einem vom Freistaat Bayern mit finanzierten Pilotprojekt für den Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen unter Einbezieung der Nachbarlandkreise mögliche Korridore untersucht.
Siehe hier.
Diese Planungen wurden in der Verkehrsprognose nicht berücksichtigt.
2.4 Entlastungswirkung Stadt-Umland-Bahn
Die Entlastungswirkung durch die geplante StUB wurde nicht hinreichend untersucht. Weder wurde die StUB berücksichtigt noch die Folgen auf den ÖPNV geprüft. Weil der Bau der Straße zu einer Verdrängung der umweltfreundlichen Stadt-Umlandbahn führen würde, ist es auch aus finanziellen Gründen abzulehnen. Es muss festgestellt werden, dass die ermittelte Verkehrsbelastung in der Hauptendorfer Straße mit lediglich 412 LKWs ab 2,8t pro Tag gering ist.
3. Sich aufdrängende Varianten wurden nicht einbezogen
Im ROV werden zwar fünf Varianten dargestellt, die aber nur marginale Unterschiede vorweisen. Der BN erkennt an, dass sich die Stadt Herzogenaurach schon lange und intensiv um eine verträgliche Lösung bemüht. Der BN ist jedoch zum Ergebnis gekommen, dass in erster Linie weiträumige, dabei aber ausschließlich nur kostengünstige Lösungen angestrebt werden. So scheint der Bau einer weit ausladenden Umgehungsstraße durch die freie Natur günstiger als eine stadtnahe Lösung. Schrittweise kleine Verbesserungen werden dabei nicht berücksichtigt. Aber auch im ersten Moment ungewöhnliche Lösungen wurden vorschnell ausgeklammert.
Wegen des enormen Naturverbrauchs sollten die nachfolgenden Alternativen und Variantenvorschläge in das ROV aufgenommen werden.
3.1 Stadt-Umland-Bahn (StUB)
Es wird nicht offengelegt, welchen Einfluss die geplante StUB auf das Verkehrsverhalten haben wird. Da stellt sich dann die Frage, wozu man die StUB eigentlich braucht. Sollte es Umfragen in den Herzogenauracher Firmen gegeben haben, um die Fahrtrouten der Mitarbeiter zu ermitteln, so tauchen sie im ROV nicht auf.
3.2 Vacher Kreuzung
Ein massives Problem sind die Linksabbieger auf der Niederndorfer Straße von der Autobahn kommend auf die Vacher Straße. Dadurch wird der Verkehrsfluss stark gestört. Durch einen reibungslosen Ablauf würde dieser Staupunkt stark entzerrt, der hauptsächlich nur zu den Stoßzeiten auftritt. Dafür wäre die Ostspange eine mögliche, erweiterbare Alternative.
Auch eine Nord-Süd-Verbindung könnte den Verkehrsfluss wesentlich verbessern. Mit dem Hans-Ort-Ring existiert bereits eine große Umfahrungsstraße, die mit der Niederndorfer Straße verbunden werden könnte, um die Ortsdurchfahrten zu reduzieren, z.B. über die
3.3 Rathgeberstraße
Dort wäre durch den Kauf einiger Häuser, die offensichtlich auch etlichen Verkaufswilligen gehören, eine notwendige Verbreiterung der Straße als mögliche Nord-Süd-Anbindung realisierbar. Oder über eine
3.4 Grünschneise
Entlang des Schwester-Ennodia-Wegs verläuft eine Grünzone in Nord-Süd-Richtung. Diese könnte man untertunneln. Dies ist zwar keine kostengünstige Lösung, wenn man aber die Umweltzerstörung der Südumgehung miteinrechnet, wohl nicht teurer. Gleiches wäre prinzipiell auch in der Niederndorfer Straße möglich.
3.5 Einbahnstraße
Es gäbe noch die Möglichkeit einer Einbahnstraße ab der A3-Abfahrt, über die Niederndorfer Straße, Erlanger Straße, Hans-Maier-Straße, Hans-Ort-Ring wieder hin zur A3-Zufahrt. Damit wäre der Verkehr durch Niederndorf sofort auf die Hälfte reduziert. Wegen des CO2-Ausstoßes wäre eine Beschränkung auf den LKW-Verkehr sinnvoll.
3.6 Ausbau Bussystem
Darüber hinaus wird im Landkreis ein erheblicher Ausbau des Bussystems geplant. Dieser wurde von vielen Bürgermeistern des Landkreises im Zuge des StUB-Bürgerentscheids proklamiert und in Aussicht gestellt. Auch dadurch sollte eine erhebliche Reduzierung des Individualverkehrs möglich sein. Obendrein wären auch noch Park-and-Ride-Plätze möglich, die im ROV keine Beachtung finden
4. Massive Eingriffe in Natur und Umwelt
4.1 Arten und Lebensräume
Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zeigen die Wertigkeit des südlichen Bereichs von Herzogenaurach auf, der keinesfalls mit dem nördlichen Bereich vergleichbar ist. So wird eine stattliche Anzahl von Brutvögeln und Durchzüglern aufgelistet, die auf der Roten Liste Bayerns genannt werden.
Selbst in stadtnahen Bereichen in der Nähe der Schaeffler-Werke findet man europarechtlich geschützte Arten. Es kann hier ein Verbotstatbestand ausgelöst werden. Von solchen Konfliktbereichen gibt es mehrere. Aufgrund der früher oder später einsetzenden Siedlungsstrukturen entlang der Umgehung, wäre es realistischer, von einer Zerstörung der heutigen biologischen Vielfalt auszugehen.
Im Untersuchungsgebiet kommen eine Reihe geschützter Arten wie Laubfrosch, Kammmolch, verschiedene Fledermausarten, Zauneidechse, Grüne Keiljungfer, Grauspecht und Mittelspecht, Pirol, Eisvogel, sowie Vögel der Feldflur wie Braunkehlchen, Feldlerche, Schafstelze, Goldammer oder Neuntöter vor.
Mit jeder der geplanten fünf Varianten würde eine Zerschneidung von mehreren, sehr naturbelassenen, quer zur geplanten Straße verlaufenden Tälern erfolgen. Damit würden wichtige Wanderwege, vor allem für Amphibien durchtrennt. Aber auch Flugrouten von Fledermäusen würden zerstört oder mindestens stark beeinträchtigt.
4.2 Landschaftsbild, Naherholung
Auch die Naherholung würde durch die äußerst dominante Straße sehr beeinträchtigt. Verantwortlich dafür sind die geplanten großen Landschaftsveränderungen durch zum Teil bis zu 18 Meter hohe Dämme oder Einschnitte. Mit dem geplanten Projekt würde ein nennenswerter Eingriff in das Landschaftsbild erfolgen, Naturräume zerschnitten und der Erholungswert erheblich beeinträchtigt.
4.3 Landwirtschaftliche Nutzbarkeit
Ebenso würden die Landwirte durch eine unwirtschaftliche Teilung ihrer Äcker und der erschwerten Zufahrt zu ihren Grundstücken schlechter gestellt. Wertvolle Ackerflächen gingen für immer verloren.
4.4 Flächenverbrauch
Die geplante Neubaumaßnahme würde zu einem erheblichen, aber vermeidbaren Flächenverbrauch führen. Ebenso würde einer zukünftigen Siedlungserweiterung im Süden Herzogenaurachs der Weg bereitet. Es besteht die Gefahr, dass es nicht nur im Norden, sondern auch im Süden zu weiteren Industrie-/Gewerbeansiedlungen kommt, wodurch die Stadt durch Straßen und Gewerbegebiete eingekesselt wird. Die Zersiedlung würde stark angeheizt.
5. Widerspruch zur Landesplanung
Das geplante Vorhaben steht im Klaren Widerspruch zu einer Reihe von Landesplanerischen Vorgaben und ist daher abzulehnen. Aussagen/Positionen des/zum Landesentwicklungsprogramm LEP in Kurzform:
LEP 3.1 Flächensparen
Grund und Boden sind ein nicht vermehrbares Gut und haben auch eine wichtige Funktion für den Naturhaushalt.
LEP 5.4 Land- und Forstwirtschaft
Auch hier werden Flächen in erheblichem Umfang in Anspruch genommen und damit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Im Rahmen weiterer Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen kommt dem Erhalt hochwertiger Böden auf Grund ihrer hohen Ertragsfähigkeit besondere Bedeutung zu.
LEP 7.1 Natur und Landschaft
Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden. Natur und Landschaft sind unverzichtbare Lebensgrundlage.
LEP 7.1.6 Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem
Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Das geplante Vorhaben steht nicht nur im Widerspruch zu europarechtlichen-, nationalen und bayrischen Naturschutzgesetzgebung, sondern auch zur Bayerischen Biodiversitätsstrategie.
Der BN bittet, die Planung als landesplanerisch negativ zu bewerten.
Für Rückfragen:
Helmut König Dr. Horst Eisenack
1. Vorsitzender Beisitzer, 09132-5352
BN Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach
02.09.2015 - BN erstattet Anzeige wegen Störung im NSG Mohrhof
Die Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des BUND Naturschutz (BN) hat am 2. September 2015 Anzeige bei der Polizeiinspektion Höchstadt und beim Umweltamt im Landratsamt Erlangen-Höchstadt wegen Ordnungswirdrigkeiten im NSG Mohrhof erstattet.
Am Samstag, den 22.08.2015 wurden auf dem Damm südlich der dem BN gehörenden Westfeldweiher westlich der für den öffentlichen Verkehr gesperrten Straße zwischen Poppenwind und Mohrhof im Naturschutzgebiet (NSG) „Vogelfreistätte Weihergebiet bei Mohrhof“ Personen beobachtet, die dort fünf Autos mit Kennzeichen aus Ludwigsburg (Baden-Württemberg) abgestellt hatten und auf Campingstühlen verfolgten, wie zwei Hunde von einer Frau immer wieder mittels Vogelattrappen in den Weiher gescheucht wurden. Zeitgleich dazu wurden immer wieder Schüsse abgegeben. Im Umfeld befand sich noch eine Person, die eine Fotokamera mit einem Objektiv mit langer Brennweite und Schulterstütze im Anschlag hatte, und offensichtlich Bilder von aufgescheuchten Vögeln machte.
Der Vorgang wurde von Vogelbeobachtern, die in der Nähe waren, aufgrund der Schüsse beobachtet und fotografiert. Diese haben die Personen angesprochen, welche unfreundlich reagierten, und den Zeugen drohten, dass sie mit Konsequenzen zu rechnen hätten, falls sie die Bilder veröffentlichen sollten. Die Polizei wurde gerufen, die Personalien der Gruppe wurden aufgenommen. Nach eigenen Angaben handelte es sich bei dem Treiben um eine jagdliche Hundeausbildung, die im NSG auf Einladung des hiesigen Jagdpächters durchgeführt wurde. Die Aktion fand am 22. August statt, also 10 Tage, bevor der Weiherdamm betreten werden darf und die Jagd auf Enten beginnt.
Aus Sicht des BN wurde dabei gegen mehrere Verordnungen und Gesetze verstoßen:
- nach NSG Verordnung vom 5.8.1982, GVBl. 21/1982 ist es verboten
- die Lebensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflanzen zu stören … (§4 Abs 1 Ziff. 9)
- freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen (§4 Abs 1 Ziff. 12)
- außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen mit Fahrzeugen aller Art oder mit Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen (§4 Abs 2 Ziff. 1)
- in der Zeit vom 1. März bis 31. August die Wege auf den Dämmen der Weiher und das sonstige Gelände außerhalb der übrigen Straßen und Wege zu betreten (§4 Abs 2 Ziff. 2).
Für Befreiungen von den Verboten ist die Höhere Naturschutzbehörde zuständig (§6 Abs 2). Dort war vom Vorgang nichts dergleichen bekannt.
Selbst wenn ein Jagdberechtigter anwesend war, sind ggf. Hundeabrichtung und insbes. Fotoaufnahmen und die Mitnahme weiterer Personen einschließlich Fahrzeuge nicht als „rechtmäßige Ausübung der Jagd bzw. Ausübung des Jagdschutzes“ gem. § 5 Abs. 1, Ziff. 4. von den Verboten der NSG-Verordnung ausgenommen. - nach Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten
- wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen (§39 Abs 1).
An dem Weiher gibt es einen der wenigen Standorte der vom Aussterben bedrohten Rohrdommel in Bayern.
- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§44 Abs. 1 )
Konkret sind zwei Brutreviere Zwergdommeln, Drosselrohrsänger, Rohrschwirl, Wasserralle sowie diverse Entenarten betroffen. - Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung
- durch Befahren einer mit Zeichen 260 StVO für motorisierten Verkehr gesperrten Straße.
Da der BN Eigentümer der Grundstücke ist, behalten wir uns vor zivilrechtlich wegen Besitzstörung (§ 862 BGB) und ggf. mit einer Schadenersatzklage gegen die betroffenen Personen vorzugehen. Die in den Weihern herangezüchteten Karpfen des Projektes „Karpfen pur Natur“ wurden durch die Hunde massiv gestört, was aufgrund des durch die lang anhaltende Trockenheit bedingten Sauerstoffmangels im Wasser zu erheblichen Schäden führen kann.
Der BN fordert die Polizei sowie die zuständigen Naturschutzbehörden auf, konsequent gegen diesen Vandalismus vorzugehen.
Gleichzeitig nehmen wir den Vorfall zum Anlass, die Entenjagd im NSG dauerhaft zu verbieten. Kein Jäger kann uns erzählen, dass er bei einem auffliegenden Vogel blitzschnell unterscheiden kann, ob es sich um eine nicht oder um eine streng geschützte Art handelt. Die Entenjagd läuft dem Naturschutzgedanken in einem Vogelschutzgebiet zuwider. Es soll dabei nicht unerwähnt bleiben, dass in zwei der drei Jagdreviere, in denen das NSG liegt, die Entenjagd seit einigen Jahren nicht mehr praktiziert wird. Allein der „gastfreundliche“ Jagdpächter führt sie noch durch.
Helmut König
1. Vorsitzender
19.08.2015 - Deponie Lonnerstadt
BN erstellt Gutachten zur Altdeponie Lonnerstadt
Im April 2015 befasste sich der Kreistag mit der undichten Altdeponie Lonnerstadt. Eine Untersuchung durch R&H Umwelt GmbH Nürnberg (R&H) im Auftrag des Landratsamtes Erlangen Höchstadt, unter deren Aufsicht die Deponie liegt, aktivierte den Kreistag. Dieser besuchte die Altdeponie, das Ergebnis wurde in der Presse veröffentlicht.
Diese schrieb damals, dass laut Umweltamtschef eine Oberflächenabdichtung, eine Abführung des Regenwassers, ein neuer Sickerwasserauffang, die Ableitung des Deponiegases als auch wiederkehrende Messungen Kosten in Millionenhöhe bedeuten würden. Es wurde die Frage gestellt, ob das verhältnismäßig sei, angesichts der niedrigen Belastung. Mit der Regierung von Mittelfranken sollte das geklärt werden. Landrat Tritthart beruhigte damals mit der Aussage, dass die Konzentration sehr niedrig sei, und „Wir werden die Sache ernsthaft angehen, aber unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit.“
Der BN hat sich das zu Herzen genommen und hat gehandelt. Unserer Bitte, das Gutachten, als auch die gesamten Messdaten zu erhalten, wurde vom Landratsamt dankenswerterweise stattgegeben. Da die Deponie im weiteren Umkreis eines geplanten Trinkwasserbrunnens in der Aischaue bei Lonnerstadt liegt, war unser Bestreben, schnellstmöglich eine Klärung der tatsächlichen Gefährdung des Grundwassers herbeizuführen. Das Landratsamt lässt bereits seit 2005 die Altdeponie regelmäßig untersuchen. In dieser Beziehung kann kein Mangel erkannt werden. Wir mussten aber feststellen, dass das Gutachten von R&H kaum Aussagen über eine zielführende Behandlung zur Minimierung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser macht. Aus diesem Grund haben wir ein Gutachten beim Geowissenschaftliche Büro Dr. Heimbucher GmbH (GBH) in Auftrag gegeben. Ziel war, auf Basis der bereits vorliegenden Daten von R&H genauere Aussagen über das Gefährdungspotenzial sowie weitere Maßnahmen zur Schadensbegrenzung der Deponie zu erhalten. Die uns dabei entstandenen Kosten nehmen wir gerne in Kauf, zum einen um die Bevölkerung vor bösen Überraschungen zu verschonen, aber auch um unserem Umweltamt eine zusätzliche Hilfestellung anzubieten.
Das Ergebnis der Untersuchung kann grob in die zwei Bereiche Bewertung und Empfehlung unterteilt werden:
⇒ Bewertung der Messdaten
Die Untersuchung von GBH stellt fest, dass die natürliche Abdichtung unter der Deponie nicht durchgängig vorhanden ist. Der Boden unterhalb der Deponie wird daher durch belastetes Sickerwasser beeinflusst. Eine obere Abdichtung fehlt. Die Oberfläche weist zudem Rillen auf, die teilweise bis zu 30 Zentimeter tief sind. Daher dringt noch mehr Wasser in den Deponiekörper ein. Der hohe Wasserstand sowie Wassergehalt in der Deponie fördert die Methangasproduktion wesentlich. Ein seitlicher Zutritt von oberflächennahem Grundwasser verstärkt dies zusätzlich. Stark belastetes Deponiesickerwasser tritt seitlich aus dem Deponiekörper wieder aus.
Damit ist eine hohe Gefährdung des oberflächennahen Grundwassers aufgrund der hohen Schadstoffbelastung im Deponiesickerwasser gegeben. Durch die erhöhte Schadstoffkonzentration im oberflächennahen Grundwasser ist eine Verunreinigung des tieferen Grundwassers zu erwarten und wahrscheinlich. Etliche der vorhandenen Schadstoffe haben die Bedenklichkeitsschwelle bereits überschritten.
⇒ Empfohlene Sanierungsmaßnahmen
Ein Trenndamm an der Deponiebasis fehlt, dadurch wird eine nachträgliche Abdichtung schwierig und vor allem äußerst kostspielig. Aus diesem Grund werden die folgenden Maßnahmen empfohlen. Aus BN-Sicht sollten diese keinesfalls auf die lange Bank geschoben werden. Es wird somit empfohlen:
- Anbringung einer Oberflächenabdichtung mit Entwässerungs- und Rekultivierungsschicht.
- Erstellung einer Hangdrainage im Westen, um das Eindringen von oberflächennahem Grundwasser in den Deponiekörper zu unterbinden.
- Drainage am östlichen Deponiefuß, um das Deponiewasser zu fassen und entsprechend abzuleiten.
- Erstellung einer Gasdrainage.
- Errichtung von drei neuen Messstellen für tiefes Grundwasser, um auch die tatsächlichen Grundwassereinträge erfassen zu können.
- Einzäunung des Deponiegeländes.
Der BN hält diese vorgeschlagenen Maßnahmen für angemessen und erforderlich für die Sicherheit der Wasserversorgung. Die zu erwartenden Kosten dieser Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis zu einer erheblich teureren Umlagerung der Deponie oder zu einer nachhaltigen Schädigung der Höchstadter Wasserqualität. Die Unterlagen der Untersuchung durch GBH stellen wir dem Landratsamt kostenlos zur Verfügung.
Helmut König
1. Vorsitzender
21.07.2015 - Fehlendes Energiekonzept im Baugebiet Reuthsee, Adelsdorf
Der BUND Naturschutz (BN) hat zum geplanten Wohngebiet Reuthsee als Träger öffentlicher Belange eine ausführliche Stellungnahme zur aktuellen Planung abgegeben. Darin wird festgestellt, dass Umwelt- und Naturschutzbelange zufriedenstellend beachtet werden. Dieses Gebiet wurde schon im Flächennutzungsplan 1986 als mögliche Baufläche ausgewiesen.
Aus energetischer Sicht müssen wir aber größere Mängel feststellen, die einem so großen Baugebiet in Anbetracht des Energiewende-Zeitalters nicht gerecht werden. Das Thema ist keinesfalls einfach. Daher kann man es auch nicht nur einem Investor überlassen: Der versucht zwar sehr ökologisch, aber trotzdem so kostengünstig wie möglich zu bauen, um die Wohnungen günstig zu verkaufen.
Städtebauliche Anforderungen
Das geplante Wohngebiet umfasst 18 Hektar mit bis zu 560 Wohneinheiten. Zum ersten Mal kommt städtischer Charakter nach Adelsdorf. Hierfür ist auch ein modernes zukunftsweisendes Energiekonzept erforderlich. Zwar belegt der Investor in der bestehenden Planung nach geltender Energieeinsparverordnung (EnEV) beste Werte im Vergleich zu den sonst üblichen Gebäuden. Andererseits wird als typisches Haus ein unterkellertes Reihenendhaus aufgeführt, das im Endenergiebedarf aufgrund der hohen Nutzfläche zwar günstig ist, aber im Primärenergiebedarf nur 91 Prozent der gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Bei kleinerer Nutzfläche verschlechtert sich der Wert weiter. Dies bedeutet eigentlich, dass das Haus durch die KfW nicht förderfähig wäre.
Die bestehende Planung soll dabei keinesfalls schlecht geredet werden. Der Investor plant die Gebäude durchaus hochwertig mit Vollwärmeschutz, individueller Gasheizung mit Brennwerttechnik und Warmwasserspeicher, sowie einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das ist schon ziemlich aufwändig. Aber eigentlich besagt jede Studie, dass bei großflächigen, dicht besiedelten Wohngebieten, eine zentrale Energieversorgung auf die gesamte Lebenszeit erheblich günstiger kommt. So auch die Oberste Baubehörde Bayerns in einer Arbeitshilfe zur Ortsplanung. Energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen beginnt nicht erst am Gebäude. Bereits auf städtebaulicher Ebene werden die Weichen für den späteren Energieverbrauch gestellt.
Energiekonzept nötig
Zur weiteren Berücksichtigung zählen sicherlich die Technologien, die in unserer Stellungnahme aufgelistet sind, mit gebäudebezogenen Solarkollektoranlagen, Photovoltaik mit Stromspeicher und Flächenheizungen, eventuell mit Wärmepumpen. Grundsätzlich muss man sich zumindest Gedanken über Quartierslösungen machen. Aber auch der Einsatz eines zentralen Blockheizkraftwerks (BHKW) mit eventuellem Stadtteilwärmespeicher und Eigenstromversorgung muss bedacht werden. Durch mehr Einbeziehung alternativer Energien anstelle der Gasversorgung wäre auch der Primärenergiebedarf günstiger.
Selbst die Möglichkeit der Lieferung des BHKW-Stroms an einen Aggregator zur Deckung von Regelleistung (Strom der im Bedarfsfall kurzfristig benötigt wird, um die Frequenz stabil zu halten), die obendrein sehr gut bezahlt wird, sollte berücksichtigt werden. Die jeweiligen Abnahmebedingungen wären innerhalb der Gemeinde zu managen.
Uns fehlen alternative Konzepte, die auf Basis der Adelsdorfer Möglichkeiten angedacht und durchkalkuliert wurden. Wir würden uns daher wünschen, dass der Gemeinderat dem Auftrag zur Erstellung eines professionellen Energiekonzeptes zustimmt. Denn nur so werden unterschiedliche Lösungen vergleichbar, insgesamt optimale Lösungen erzielbar und die Energiekosten auch in absehbarer Zukunft erträglich bleiben. Adelsdorf kann hier Vorbild sein auch für andere Gemeinden.
Helmut König
1. Vorsitzender
22.05.2015 - Einhaltung der Gesetze eingefordert
Der Bund Naturschutz bezieht Stellung zur Vorgehensweise eines Christbaumzüchters, der die vorgeschriebene artenschutzrechtliche Prüfung für die Umnutzung eines Ackerlandes ablehnt. Gleichzeitig weigert er sich, entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Feldlerche durchzuführen.
21.04.2015 - Anhörung A3 - BN fordert Grünbrücke
In der Anhörung zur A3 Höchstadt-Nord bis Schlüsselfeld fordert der Kreisvorsitzende in Vertretung der Kreisgruppen Höchstadt-Herzogenaurach und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim eine zusätzliche Grünbrücke.
Der Kreisvorsitzende betont nochmals die Gründe unserer Ablehnung des A3 Ausbaus, der in erster Linie mit dem steigenen Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen zusammen hängt. Dies hat Auswirkungen auf Klimaschutz, Naherholung, Lärm, Luftschadstoffe und Flächenverbrauch. Alles zusammen wird aber von den Bürgern einfach so als „Gott gegeben“ hingenommen.
Wir fordern daher vor allem eine Reduzierung des Lastverkehrs auf unseren Autobahnen. Wir wollen, dass die Bahn ihren Transportauftrag endlich ernst nimmt und verbessert. Ihre Logistik auf Vordermann bringt, und für den Fernverkehr den Transport der Güter übernimmt. Wir brauchen eine Maut, die den LKW-Verkehr bezogen auf seine Schädigungen entsprechend belastet. Dies wäre ein sinnvoller Beitrag, den wir uns zur Verbesserung der heutigen Situation dringend wünschen würden.
Grünbrücke
Die Wildkatze ist bekannterweise wie keine andere Art als beispielhafte Ziel- und Zeigerart für Wirbeltiere für einen Verbund von Waldlebensräumen besonders geeignet. Daher profitieren von ihren Wegen viele andere Tiere.
Die Planung hat nun 2 Grünbrücken, eine östlich von Abtswind (zwischen Geiselwind und Wiesentheid), und eine in der Mönau vorgesehen. Zwischen beiden liegt ein riesiger Abstand von 55 km. Dazwischen ist die Erweiterung einer Unterführung vorgesehen, die von vielen Tieren nicht angenommen wird. Gleichzeitig führt sie auf offene freie Flächen, die von Wildkatzen gemieden werden. Dies ist offensichtlich Datenbasis Bundesamt für Naturschutz (BfN).
Untersuchungen und Modelle des BUND sowie des Landesamtes für Wald und Forstwirtschaft (LWF) zeigen, wo mögliche Verbreitungswege sind. Unterschiedliche Verfahren bringen leicht unterschiedliche Aussagen. Aber alle zeigen auf, dass im Bereich Schirnsdorf eine Grünbrücke notwendig ist. Laut den BUND Modellen befindet sich hier sogar eine Hauptachse der möglichen Wildkatzenwanderung, und bei Klebheim eine Nebenachse. Laut LWF grenzt ein großes Streifgebiet bei Schirnsdorf an.
Wir fordern daher, dass im Bereich der Hauptachse bei Schirnsdorf, eine zusätzliche Grünbrücke erstellt wird. Ebenso fordern wir sowohl für Schirnsdorf als auch für die Nebenachse bei Klebheim, dass Detailuntersuchungen bezüglich der Wildkatze durchgeführt werden. Ein Experte soll vor Ort erkunden, wie geeignet die Struktur und das Gelände dort ist, um eine geeignete Querung zu ermöglichen.
Optimal wäre eine Unterstützung dieser Untersuchung durch das Aufstellen von Wildkatzenlockstöcken zur Untermauerung der Strukturanalysen, dies gilt auch für die Mönau. Sinnvoll wären diese Untersuchungen auch, um die Analysedaten, die mittlerweile über 10 Jahre alt sind, zu erneuern.
Helmut König
1. Vorsitzender
09.04.2015 - Aufruf zur naturnahen Teichbewirtschaftung
Zum Start des neuen Kreisvorsitzenden wurde an alle Bürgermeister der 15 Gemeinden, die zum Bereich der BUND Naturschutz Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach zählen, ein Begrüßungsschreiben und gleichzeitig ein Aufruf zur naturnäheren Teichbewirtschaftung gesendet.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
zunächst möchte ich mich als neu gewählter 1. Vorsitzender der Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) bei Ihnen bekannt machen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Sachen Natur- und Umweltschutz anbieten. Das von der Kreisgruppe betreute Gebiet umfasst die Gemeinden des früheren Landkreises Höchstadt a. d. Aisch. Wir vertreten hier mehr als 1600 Mitglieder.
Wie Sie sicher wissen, engagiert sich der BN im Gebiet des Aischgrundes wegen der landschaftlichen Bedeutung im besonderen Maße um den Biotop- und Artenschutz rund um die Karpfenweiher und die Erzeugung qualitativ hochwertiger Karpfen. Dies geschieht z.B. mit unserem Programm „Karpfen pur Natur“, wo wir mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken und einem erfahrenen Teichwirt erfolgreich zusammenarbeiten. Allerdings ist die Wirkung hierbei nur auf die wenigen Weiher gegeben, die dem BN gehören. In dieser Sache wenden wir uns deshalb mit einem Anliegen an alle Gemeinden und hiermit auch an Ihre, um einen weiteren Beitrag zum Erhalt einer günstigen Situation in den Weihergebieten anzustreben.
Wir beobachten nämlich schon seit längerer Zeit Verluste in der Tier- und Pflanzenwelt und die Veränderung des Landschaftsbildes unserer Weiherlandschaften. Neben Einflüssen aus der Umgebung der Weiher spielt die Art und Weise der Bewirtschaftung der Teiche eine große Rolle. Vor allem an intensiv genutzten Teichen und solchen die von Angelsportvereinen genutzt werden, ist das besonders auffällig und erkennbar z.B. am Verlust von Wasserpflanzen, Flachwasserbereichen, Schilfbeständen und Ufergehölzen und von Amphibien.
Unsere benachbarte Kreisgruppe Neustadt a. d. Aisch hat mit Unterstützung der Glücksspirale ein Projekt durchgeführt, das dieser Entwicklung entgegen wirken soll. Hierbei haben die Kommunen, die ja per Gesetz für ihre Grundstücke in besonderem Maße dem Naturschutz verpflichtet sind, die Weiherpächter und der BN in vertrauensvoller Zusammenarbeit ein vorbildliches Konzept entwickelt, das unseres Erachtens auch auf unseren Landkreis übertragen werden kann und sollte.
Wir haben deshalb die Bitte, dass auch Ihre Gemeinde im Falle der Neuverpachtung von gemeindeeigenen Karpfenteichen einige Grundsätze, die als Ergebnis des Projektes formuliert wurden, bei der Abfassung der Pachtverträge berücksichtigt werden.
Die Gemeinde setzt sich für den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer natürlichen Lebensräume ein. Dies lässt sich bei Berücksichtigung folgender Punkte gut mit der Karpfenteichwirtschaft verbinden:
- Der Weiher ist in der Amphibienzeit von Ende Februar bis in den September bespannt zu halten.
- Eine Kalkung des Weihers ist nach Abschluss der Amphibienentwicklung und dem Abwandern der Amphibien ab Juli im bespannten Weiher oder im trockenen Weiher nach dem Wintern direkt vor oder während des Bespannens möglich.
- Der Weiher soll als Karpfenweiher bewirtschaftet werden. Der Weiher sollte nicht mit Barschartigen, wie Flussbarsch oder Zander und Waller/Wels besetzt werden. Ein Besatz mit Hecht als Beifisch ist möglich.
- Der Weiher sollte nur mit heimischen und nicht mit faunenfremden Fischarten besetzt werden, da diese beim Abfischen in freie Gewässer gelangen könnten.
- Eine entstehende Röhrichtzone ist zuzulassen. Die Größe der Entwicklungsfläche ist gemeinsam abzustimmen und darf den Abfluss zum Mönch nicht beeinträchtigen. Die Röhrichtzone ist wichtig für die Laichablage und für Kaulquappen, als Standort von Jungfischen, als Vogelbrutplatz und sie gewährleistet Schutz vor Methan bedingten Sauerstoffdefiziten im Winter.
- Wasservegetation ist erwünscht und sollte toleriert werden, soweit dadurch das Ablassen des Weihers nicht gefährdet wird. Sie kann auf einzelne Weiherbereiche begrenzt werden.
- Das Einbringen von Totholz bietet Unterstand für Fische und Amphibien sowie Beherbergung von Fischnährtieren.
- Mit Uferbewuchs, z.B. Weide, Erle usw. kann die Uferböschung gesichert werden. Einzelne Weiherbereiche werden beschattet. Dadurch entstehen Temperaturunterschiede im Gewässer und Rückzugsmöglichkeiten für einzelne Fisch- und Amphibienarten.
Wir würden gerne ein mittelfristiges Projekt unterstützen, mit dem eine Erfolgskontrolle bei der Erfüllung der formulierten Ziele stattfindet. Es würde uns deshalb freuen, wenn jede Gemeinde hierfür einen für das Gebiet repräsentativen Weiher benennt, an dem beispielhaft vergleichende Untersuchungen vor und nach einer Neuverpachtung durchgeführt werden. Selbstverständlich soll dies in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den betreffenden Pachtvertragspartnern erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut König
1. Vorsitzender
BN Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach
09.04.2015 - Aufruf zur naturnahen Teichbewirtschaftung
Zum Start des neuen Kreisvorsitzenden wurde an alle Bürgermeister der 15 Gemeinden, die zum Bereich der BUND Naturschutz Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach zählen, ein Begrüßungsschreiben und gleichzeitig ein Aufruf zur naturnäheren Teichbewirtschaftung gesendet.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
zunächst möchte ich mich als neu gewählter 1. Vorsitzender der Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) bei Ihnen bekannt machen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in Sachen Natur- und Umweltschutz anbieten. Das von der Kreisgruppe betreute Gebiet umfasst die Gemeinden des früheren Landkreises Höchstadt a. d. Aisch. Wir vertreten hier mehr als 1600 Mitglieder.
Wie Sie sicher wissen, engagiert sich der BN im Gebiet des Aischgrundes wegen der landschaftlichen Bedeutung im besonderen Maße um den Biotop- und Artenschutz rund um die Karpfenweiher und die Erzeugung qualitativ hochwertiger Karpfen. Dies geschieht z.B. mit unserem Programm „Karpfen pur Natur“, wo wir mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken und einem erfahrenen Teichwirt erfolgreich zusammenarbeiten. Allerdings ist die Wirkung hierbei nur auf die wenigen Weiher gegeben, die dem BN gehören. In dieser Sache wenden wir uns deshalb mit einem Anliegen an alle Gemeinden und hiermit auch an Ihre, um einen weiteren Beitrag zum Erhalt einer günstigen Situation in den Weihergebieten anzustreben.
Wir beobachten nämlich schon seit längerer Zeit Verluste in der Tier- und Pflanzenwelt und die Veränderung des Landschaftsbildes unserer Weiherlandschaften. Neben Einflüssen aus der Umgebung der Weiher spielt die Art und Weise der Bewirtschaftung der Teiche eine große Rolle. Vor allem an intensiv genutzten Teichen und solchen die von Angelsportvereinen genutzt werden, ist das besonders auffällig und erkennbar z.B. am Verlust von Wasserpflanzen, Flachwasserbereichen, Schilfbeständen und Ufergehölzen und von Amphibien.
Unsere benachbarte Kreisgruppe Neustadt a. d. Aisch hat mit Unterstützung der Glücksspirale ein Projekt durchgeführt, das dieser Entwicklung entgegen wirken soll. Hierbei haben die Kommunen, die ja per Gesetz für ihre Grundstücke in besonderem Maße dem Naturschutz verpflichtet sind, die Weiherpächter und der BN in vertrauensvoller Zusammenarbeit ein vorbildliches Konzept entwickelt, das unseres Erachtens auch auf unseren Landkreis übertragen werden kann und sollte.
Wir haben deshalb die Bitte, dass auch Ihre Gemeinde im Falle der Neuverpachtung von gemeindeeigenen Karpfenteichen einige Grundsätze, die als Ergebnis des Projektes formuliert wurden, bei der Abfassung der Pachtverträge berücksichtigt werden.
Die Gemeinde setzt sich für den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer natürlichen Lebensräume ein. Dies lässt sich bei Berücksichtigung folgender Punkte gut mit der Karpfenteichwirtschaft verbinden:
- Der Weiher ist in der Amphibienzeit von Ende Februar bis in den September bespannt zu halten.
- Eine Kalkung des Weihers ist nach Abschluss der Amphibienentwicklung und dem Abwandern der Amphibien ab Juli im bespannten Weiher oder im trockenen Weiher nach dem Wintern direkt vor oder während des Bespannens möglich.
- Der Weiher soll als Karpfenweiher bewirtschaftet werden. Der Weiher sollte nicht mit Barschartigen, wie Flussbarsch oder Zander und Waller/Wels besetzt werden. Ein Besatz mit Hecht als Beifisch ist möglich.
- Der Weiher sollte nur mit heimischen und nicht mit faunenfremden Fischarten besetzt werden, da diese beim Abfischen in freie Gewässer gelangen könnten.
- Eine entstehende Röhrichtzone ist zuzulassen. Die Größe der Entwicklungsfläche ist gemeinsam abzustimmen und darf den Abfluss zum Mönch nicht beeinträchtigen. Die Röhrichtzone ist wichtig für die Laichablage und für Kaulquappen, als Standort von Jungfischen, als Vogelbrutplatz und sie gewährleistet Schutz vor Methan bedingten Sauerstoffdefiziten im Winter.
- Wasservegetation ist erwünscht und sollte toleriert werden, soweit dadurch das Ablassen des Weihers nicht gefährdet wird. Sie kann auf einzelne Weiherbereiche begrenzt werden.
- Das Einbringen von Totholz bietet Unterstand für Fische und Amphibien sowie Beherbergung von Fischnährtieren.
- Mit Uferbewuchs, z.B. Weide, Erle usw. kann die Uferböschung gesichert werden. Einzelne Weiherbereiche werden beschattet. Dadurch entstehen Temperaturunterschiede im Gewässer und Rückzugsmöglichkeiten für einzelne Fisch- und Amphibienarten.
Wir würden gerne ein mittelfristiges Projekt unterstützen, mit dem eine Erfolgskontrolle bei der Erfüllung der formulierten Ziele stattfindet. Es würde uns deshalb freuen, wenn jede Gemeinde hierfür einen für das Gebiet repräsentativen Weiher benennt, an dem beispielhaft vergleichende Untersuchungen vor und nach einer Neuverpachtung durchgeführt werden. Selbstverständlich soll dies in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den betreffenden Pachtvertragspartnern erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut König
1. Vorsitzender
BN Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach
08.12.2014 - BN lehnt A3-Ausbau ab
Der BUND Naturschutz (BN) als Träger öffentlicher Belange hat seine Stellungnahme an die Regierung von Mittelfranken zur Erweiterung der A3 im Bereich Höchstadt-Ost bis Klebheim, und zur PWC-Anlage erläutert.
Ausbau der A3
Der BN lehnt die sechsspurige Erweiterung der Autobahn ab. Dafür gibt es aus Sicht des BN mehrere Gründe. Neben einer formalen Verfahrensunterlassung durch die Regierung, die mit Europarecht kollidiert, ist auch der Bedarf nicht schlüssig nachgewiesen, und berücksichtigt nicht zukünftige Rahmenbedingungen. Des weiteren wird durch den Ausbau der KFZ-Verkehr begünstigt und damit noch mehr Verkehr ausgelöst. Der einhergehende CO2-Ausstoß untergräbt die Beschlüsse des Klimaschutzes der Bundesregierung. Die Zunahme von Luftschadstoffen und von Lärm in den abführenden Straßen werden nicht berücksichtigt. Letztendlich beträgt der Flächenverbrauch alleine in diesem 10,9 km langen Streckenabschnitt inklusive PWC-Anlage um 16,2 Hektar.
„Wir fordern daher eine massive Verlagerung zumindest des Güterverkehrs auf die Schiene, inklusive eines epochalen Innovationssprunges in der Bahnlogistik samt der notwendigen Durchsetzung“, betont der Kreisvorsitzende Sigfried Liepelt.
Aber auch Positives muss erwähnt werden. Abgesehen gerade vom letzten Streckenabschnitt an der PWC-Anlage werden bis auf drei weitere alle restlichen 7 Streckenabschnitte nun über Absetzbecken und Regenrückhaltebecken entwässert. Vorher ging alles lediglich über einen Entwässerungsgraben in den Vorfluter oder sogar in den Karpfenweiher.
PWC Seeleiten
Auch der BN sieht die Notwendigkeit von Ruhepausen für LKW-Fahrer. Was er jedoch keinesfalls einsieht ist die fixe Forderung, dass alle 15-20 Kilometer eine PWC-Anlage gebaut werden muss. Und das genau in einem Streckenabschnitt, der einen äußerst sensiblen Naturraum darstellt. Neben vielen kleinen Biotopflächen finden sich etliche Naturschutzgebiete und europäisch geschützte Flächen. "Wir können uns nicht vorstellen, dass diese stringente Einteilung in ganz Deutschland so eingehalten wird" meint Helmut König, Ortsvorsitzender BN Adelsdorfs, „und damit lehnen wir die PWC-Anlage in diesem Streckenabschnitt ab.“
Weitere Mängel der PWC-Anlage
Falls nun doch gebaut wird, fordert der BN weitere Mängel der aktuellen Planung zu beheben. Dazu zählen die mangelhafte naturschutzfachliche Untersuchung aller Waldstandorte, als auch die nicht nachvollziehbare Bewertung im Standortvergleich. „Keinesfalls darf Schmutzwasser in den Klebheimer See eingeleitet werden, und der Lärmschutz für Klebheim muss verbessert, und ein permanenter Schutzzaun angebracht werden.“ betont König. Auch ist ein Amphibienschutzzaun entlang der A3 zu erstellen, als auch eine zusätzliche Grünbrücke westlich von Geiselwind einzuplanen. Letztere dient vor allem zur Unterstützung der Wildkatzenkorridore.
Bei Rückfragen:
Helmut König
helmut.koenig@bund.net.de
2013 - Teichgebiet bei Bösenbechhofen unter Naturschutz gestellt
Dank der Bemühungen von Dr. Krautblatter, der unteren Naturschutzbehörde ERH und anderen Mitstreitern ist das Teichgebiet nördlich von Bösenbechhofen endlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden.
Diese Weiher gehören zu den letzten Kleinodien unserer fränkischen Teichlandschaft. Sie stellen von der landschaftlichen Vielgestaltigkeit sowie vom Arten- und Biotopreichtum einen besonders schützenswerten Ausschnitt aus der selten gewordenen und bedrohten traditionellen Kulturlandschaft des Aischgrunds dar. Die Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach des Bunds Naturschutz (BN) hatte bereits 2003 die Ausweisung zum Naturschutzgebiet beantragt. Auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) unterstützte diesen Antrag.
Während die weite Verebnung des Mohrhofgebiets mit seinen großen Teichen vornehmlich der brütenden Vogelwelt zu Gute kommt, handelt es sich bei den Bösenbechhofner Weihern um eine schmale Kette relativ kleiner Teiche mit nährstoffarmem Wasser, die insbesondere vielen hochbedrohten Libellen, Amphibien und besonders vielen seltenen Pflanzenarten Lebensraum bieten.